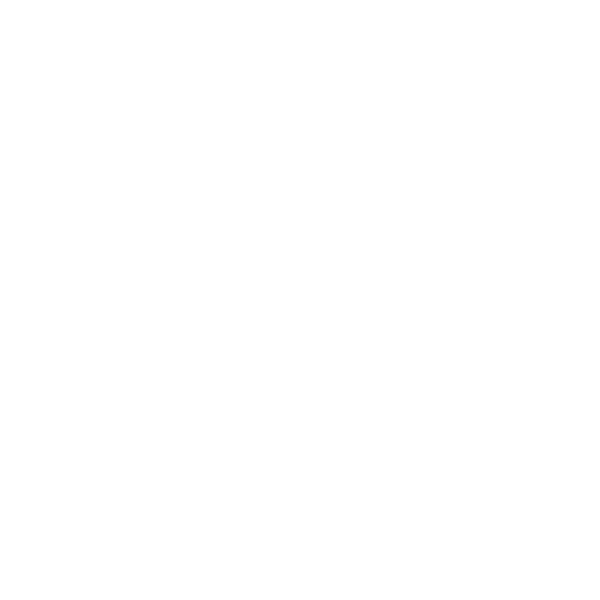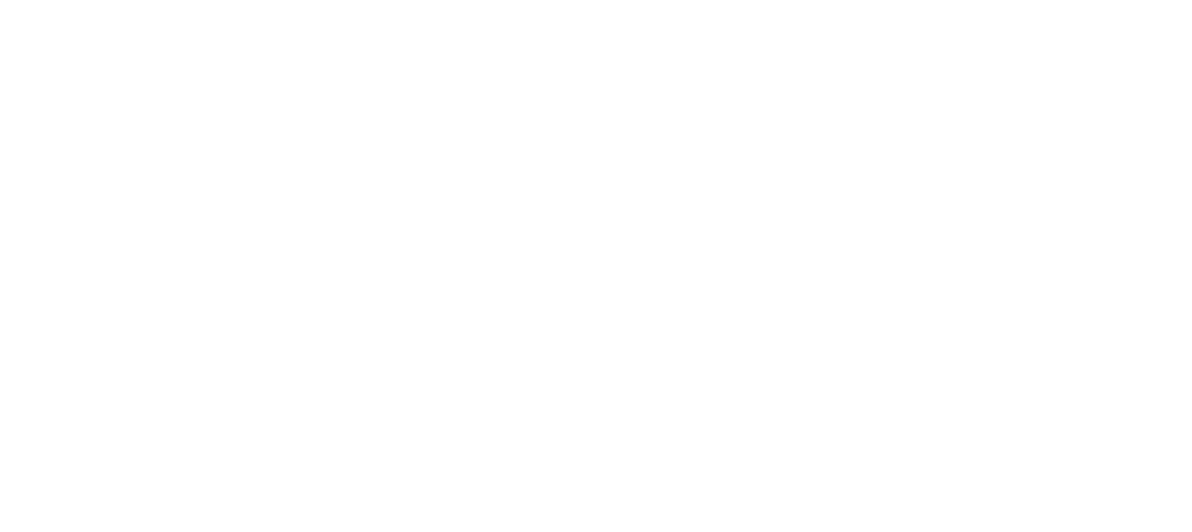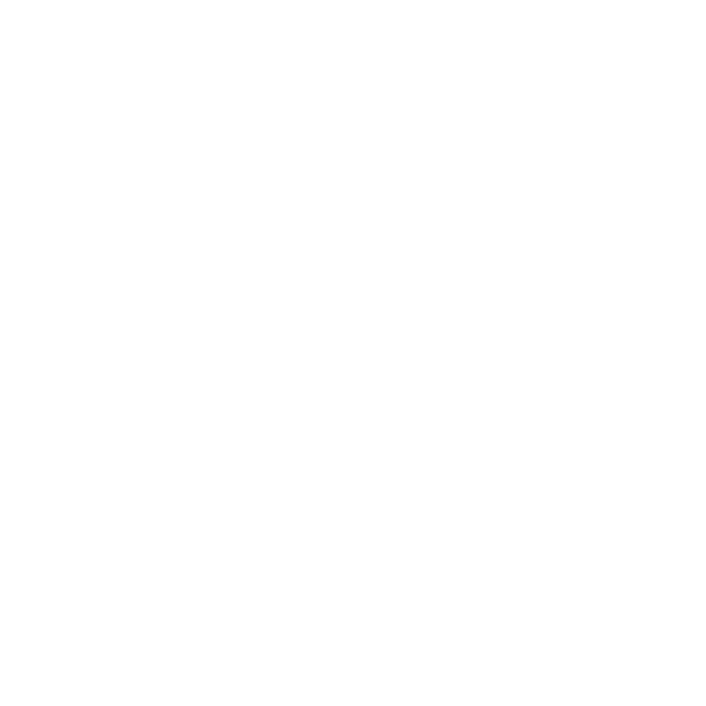Die Universität Witten/Herdecke ist durch das NRW-Wissenschaftsministerium staatlich anerkannt und wird – sowohl als Institution wie auch für ihre einzelnen Studiengänge – regelmäßig akkreditiert durch:
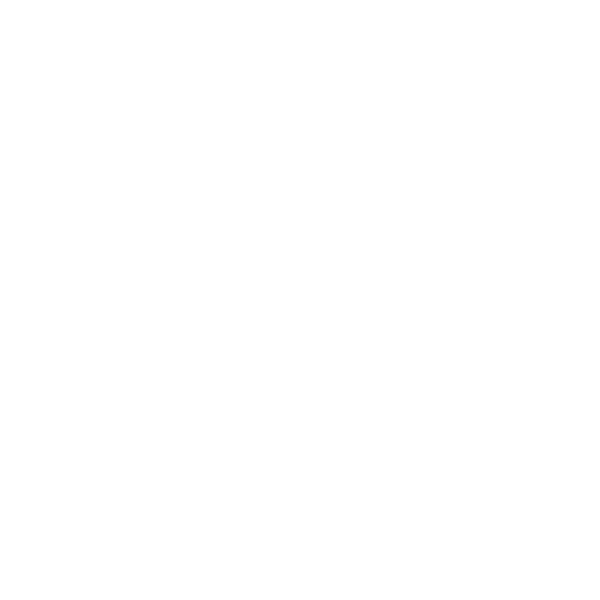
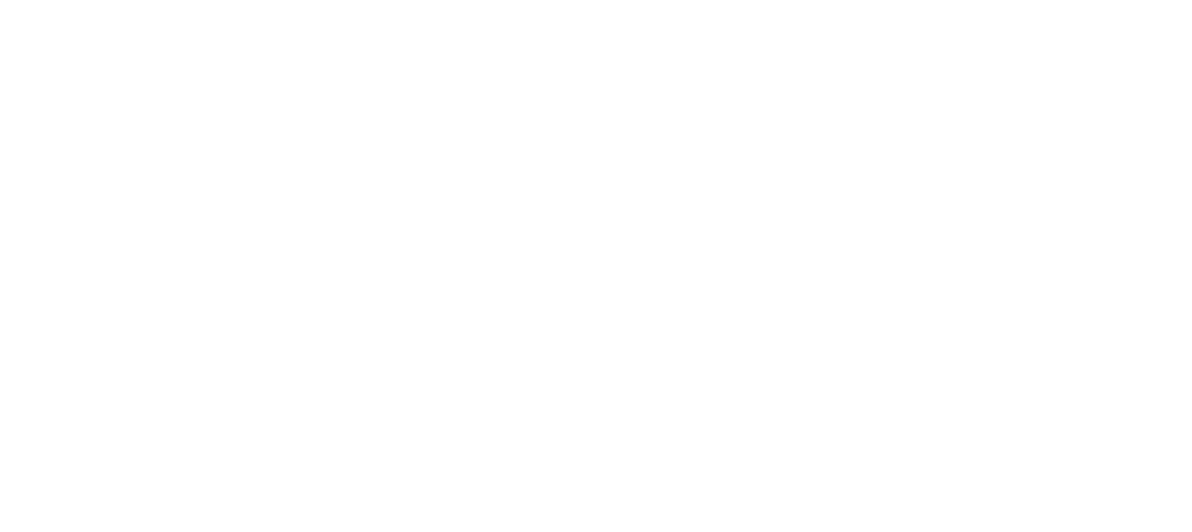
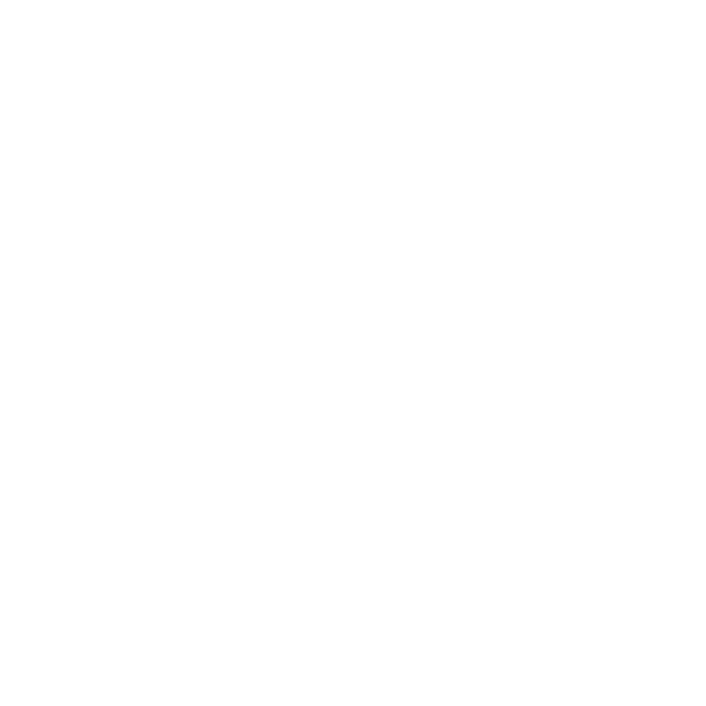
Hintergrund
Typ-1-Diabetes (T1D) scheint in Europa auf dem Vormarsch zu sein, und mit ihm die Belastung durch eine Reihe von Ergebnissen, darunter Gesundheitszustand, Produktivität, Aktivität und Nutzung von Gesundheitsressourcen (You & Henneberg 2016). Die Komplexität des Diabetes selbst, Blutzuckerschwankungen und die Angst vor Langzeitkomplikationen tragen zu einer hohen diabetesspezifischen Belastung bei (Bollepalli et al. 2012). Etwa 373.000 Erwachsene und 32.000 Kinder mit T1D (Fisher et al. 2016) leben in Deutschland, die Rate neuer Fälle von T1D steigt derzeit jährlich um 3,5 % (http://T1dtoolkit.org).
Nach internationalen Übersichten wird offensichtlich, dass trotz moderner Technologien wie Insulinpumpen und Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung die glykämische Kontrolle für die meisten Menschen mit Typ-1-Diabetes suboptimal bleibt (Prigge et al. 2022). Durch die in Deutschland implementierten Disease Managementprogramme konnte erreicht werden, dass inzwischen ca. 50 % der Betroffenen den vereinbarten HBA1c-Wert erreichen. Aber nach wie vor sind Menschen mit T1D einem erhöhten Risiko ausgesetzt, psychologische und neurologische Langzeitfolgen wie Depressionen und kognitiven Verfall oder makrovaskuläre und mikrovaskuläre Komorbiditäten zu entwickeln (Buchberger et al. 2016). 25,5% aller T1D-Patienten in Deutschland leiden bereits an einem Doppeldiabetes (Merger et al. 2016).
Es stellt sich die Frage, welche Ressourcen Menschen mit einer derart komplexen Erkrankung wie T1D entwickeln und welche Unterstützung sie dabei nutzen können. Welche integrativ-medizinischen Zugänge können für sie hilfreich sein?
Hypothesen
Betroffene haben immer wieder die bisherigen Behandlungskonzepte aus ihrer Perspektive heraus erweitert (Insulindosisanpassung, Sport, Fasten, Closed Loop). Betroffene haben nun entdeckt, dass eine eingeschränkte emotionale Regulations-kompetenz ein angemessenes Diabetesmanagement behindern kann (6). Dabei kann es sich individuell um sehr verschiedene Aspekte - von einer fehlenden Stressregulations-fähigkeit über auto-aggressive Verhaltensmuster bis hin zu Depressionen oder traumatische Belastungen- handeln. Es mag hilfreich sein, die eigenen Prozesse zu verstehen und angemessene Regulationskompetenzen zu erlernen. Gut evaluierte Programme zur Förderung der emotionalen Kompetenz, wie das Zürcher Ressourcenmodell und die Schulungen im Bereich des Somatic Experiencings und andere helfen dabei. Wir wollen dies nun untersuchen, um zu prüfen, ob sie langfristig in die Versorgung von Menschen mit T1D integriert werden können.
Fragestellung der Studie
Trifft das Programm auf das Interesse der Betroffenen? Nehmen ausreichend Betroffene an dem Programm teil? Wie nehmen sie die Module wahr? Kann emotionale Regulation durch Menschen mit T1D erlernt und in den Alltag integriert werden? Könnte diese Kompetenz dazu beitragen das Wohlbefinden zu steigern und die Risikofaktoren für einen zusätzlichen T2D sowie für Depressionen und weitere Folgeerkrankungen zu senken?
Ethik: Ein positives Votum wurde durch die Ethikkommission der Uni Witten/Herdecke erteilt.
Intervention
Der neu entwickelte Jahreskurs soll in die gemeinsame Erforschung von Möglichkeiten einsteigen, nicht nur den Blutzucker regulieren zu können, sondern auch Selbsthilfe- Techniken zur Regulation von emotionalen und Stressbelastungen zu entwickeln. Wir nutzen hierfür moderne Erkenntnisse und Werkzeuge aus der Psycho-Neuro-Immunologie der aktuellen Stressforschung, dem Zürcher Ressourcenmodell und dem Somatic Experiencing nach Peter Levine und der Introspektionsforschung. Begleitet und vertieft werden alle Schritte durch Achtsamkeitsübungen und Leistungsdruckfreien Wahrnehmungs- und Bewegungsspielen im Kontext von Musik und Bewegung.
Sponsoring
Die Studie wird gefördert von der Chaja-Stiftung chaja-stiftung.de
Weitere Informationen finden Sie auf der U-Health-Projektseite.
Fasten, definiert als der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung über einen bestimmten Zeitraum - wird in zahlreichen Religionen seit Jahrtausenden praktiziert und ist aus der modernen Naturheilkunde als eine wichtige Intervention bekannt, die sich wohltuend auf verschiedene Beschweren auswirken kann.
Das Buchinger Fasten ist eine leitlinienbasierte multimodale Intervention, und umfasst neben der nur auf Flüssigkeiten (Brühe, Wasser, Tee) basierenden Ernährung auch Bewegung, ressourcenorientiertes Training und Achtsamkeit.
Für Menschen mit Typ 1 Diabetes war die Durchführung von Fasteninterventionen bislang verboten. Wir haben die Machbarkeit, die positiven Auswirkungen als auch fastenbedingte Nebenwirkungen untersucht und festgestellt: Fasten für Menschen mit T1DM ist möglich – unter Berücksichtigung der gegebenen Risikofaktoren.
Außerdem konnten wir verschiedene Unterstudien realisieren. Wir konnten überprüfen, welche Auswirkungen das Fasten auf den Säure-Basenhaushalt der Studienteilnehmer hat. Auch die Auswirkungen des Fastens auf die Kognition haben wir in einer Pilotstudie untersucht.
Die Verleihung des Holzschuhpreises der Hufeland-Gesellschaft im Jahr 2021 unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeit und die Notwendigkeit der Fortsetzung dieser Arbeit.
Weitere Studien sind in Vorbereitung, bitte kontaktieren Sie uns gerne!
Ca. 32.000 Kinder in Deutschland leben mit der Diagnose Typ 1 Diabetes. Der Trend ist steigend – insbesondere unter der Corona-Pandemie stieg der Anteil der Kinder mit neudiagnostiziertem T1DM, diabetischen Ketoazidosen bei Erstdiagnose und schlechten Blutzuckereinstellungen nach der Diagnose an. Kinder müssen lernen, bei all ihren Aktionen, beim Toben, Spielen und Essen die Auswirkungen auf den Blutzucker zu bedenken. Durch die App-und Sensor-basierte kontinuierliche Glukose- Überwachung ist es heute möglich, dass diesen Job auch die Eltern übernehmen. Dennoch geht es darum, dass die Kinder neben der Blutzuckerregulation eine umfassende Lebensqualität entwickeln können. Um das überprüfen zu können, haben wir eine eigene Selbstwirksamkeitsskala für Kinder und Jugendliche entwickelt und validiert. Wir konnten ein ganzheitliches Schulungsprogramm für Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes abbilden, welches die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz einbezieht.
Trotz der immer weiteren Verbesserung der technischen Möglichkeiten im Diabetesmanagement sind die Risiken der Folgeerkrankungen und die Kosten der Diabeteserkrankung im Alter hoch. Wir gestalten Forschung aus der Perspektive der Betroffenen in Zusammenarbeit mit zahlreichen etablierten Forschungsgruppen und anderen Betroffenen von Typ 1 Diabetes. Wir teilen und diskutieren unsere Forschungsergebnisse im Institut für erste Personen-Forschung der Universität Witten/Herdecke (Link). Wir arbeiten an den Zusammenhängen zwischen Stress und Diabetes-Selbstmanagement und entwickeln ein Programm zur emotionalen Regulationskompetenz (U-Health-Long Version). Wir erkunden die Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien. Dabei untersuchen wir, welche Unterstützung traditionelle oder integrative Behandlungskonzepte anbieten können.


Dr. phil.
Bettina Berger
Fakultät für Gesundheit (Department für Humanmedizin)
Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Tel.: +49 2330 80-7190
E-Mail: Bettina.Berger@uni-wh.de
E-Mail: Jetzt E-Mail senden
vCard: vCard herunterladen
Die Universität Witten/Herdecke ist durch das NRW-Wissenschaftsministerium staatlich anerkannt und wird – sowohl als Institution wie auch für ihre einzelnen Studiengänge – regelmäßig akkreditiert durch: