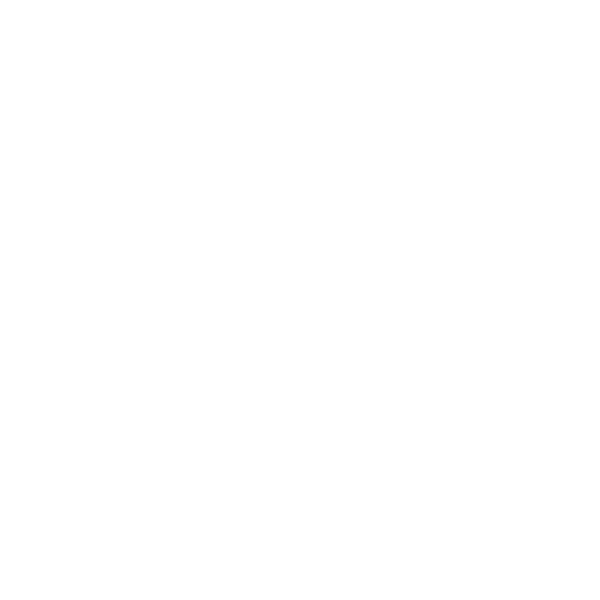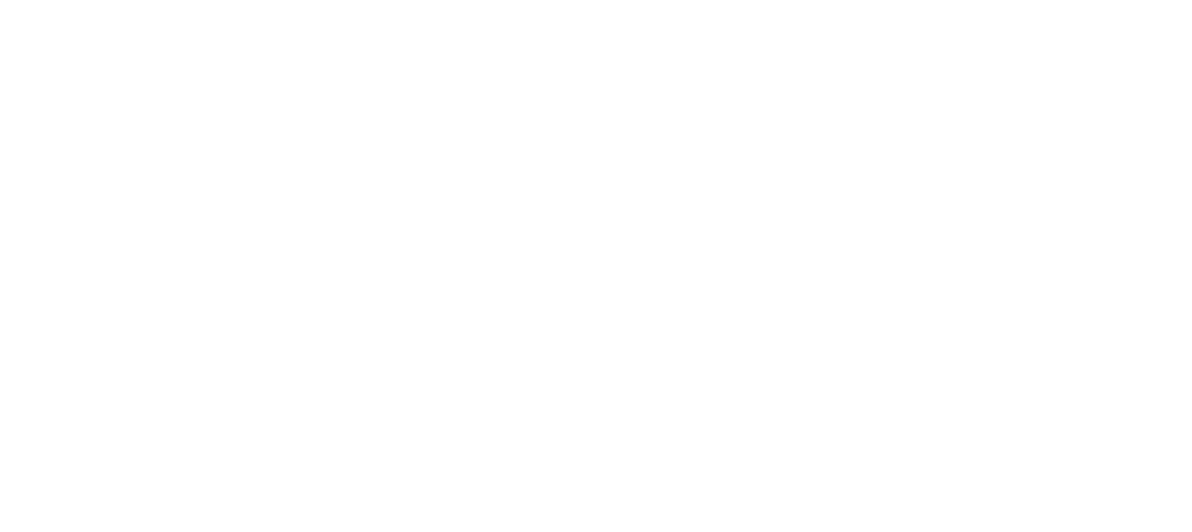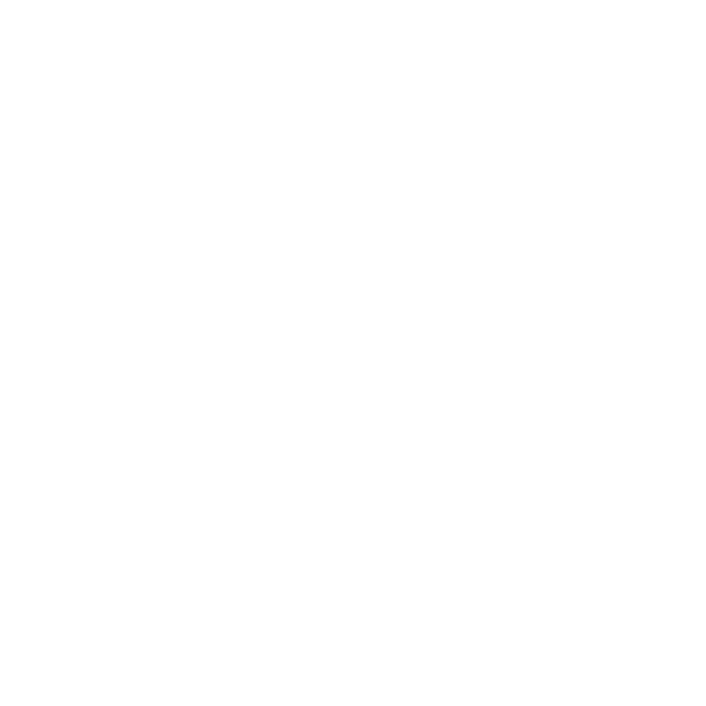Die Universität Witten/Herdecke ist durch das NRW-Wissenschaftsministerium staatlich anerkannt und wird – sowohl als Institution wie auch für ihre einzelnen Studiengänge – regelmäßig akkreditiert durch:
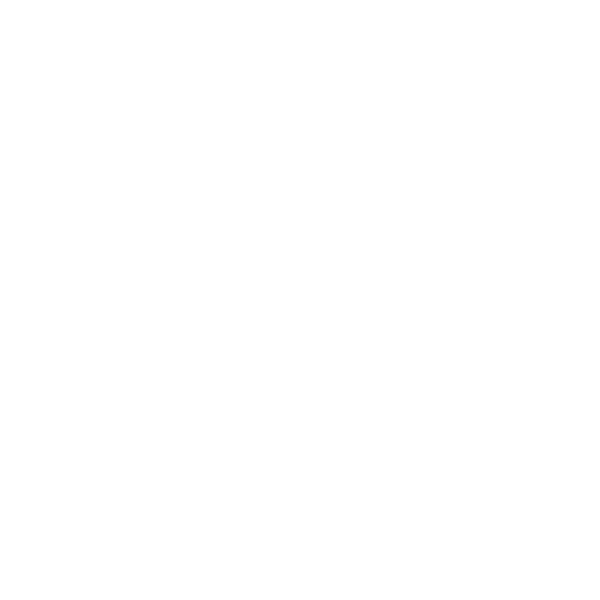
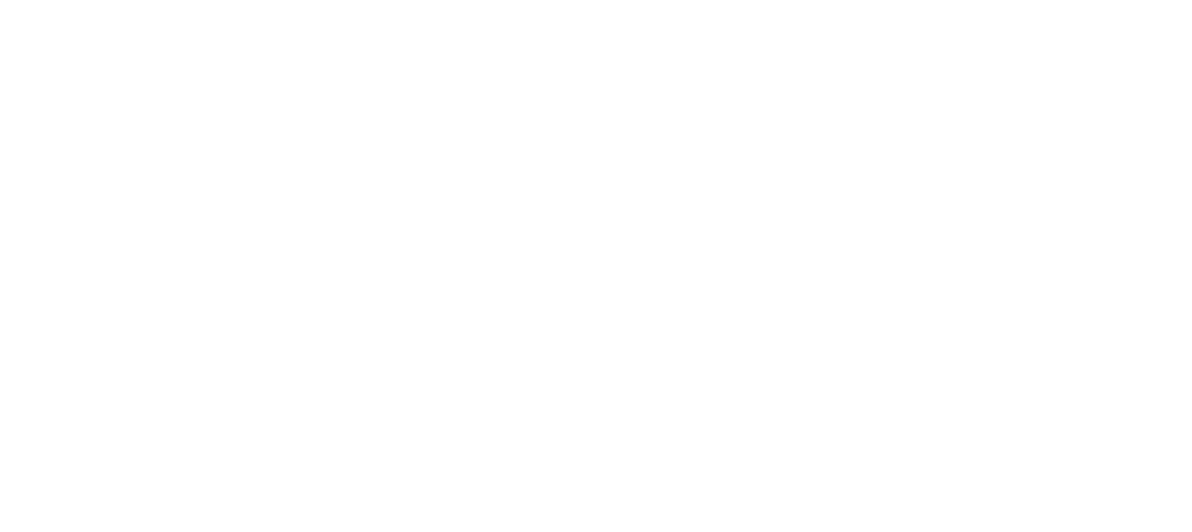
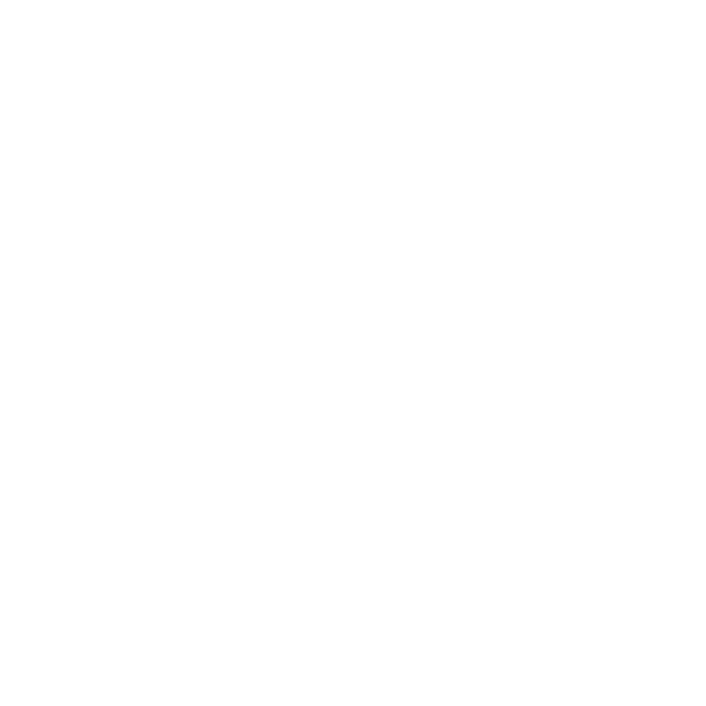
„Organisation und Mythos“ geht zurück auf eine Tagung im März 2022 in Kooperation des RMI mit der Universität Siegen, konzipiert und kuratiert von Prof. Dr. Thomas Klatetzki (Uni Siegen) und Prof. Dr. Günther Ortmann (RMI), die nun auch Herausgeber des nun erschienenen Bandes bei Velbrück Wissenschaft sind. Er enthält Beiträge von Dirk Baecker, Timon Beyes, Stefanie Büchner, Alfred Kieser, Maximilian Locher, Maria Moss, Elke Weik, Bennet van Well, Stephan Wolff und den Herausgebern. Ihre interdisziplinären Betrachtungen zeigen Mythen des Organisierens und der Organisationen in einem neuem, vielleicht überraschend positiven Licht: "Myths matter" (Titel der Einleitung, S.7).
Mit einer Abschlusspräsentation vor Führungskräften und dem geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, Herrn Bastian Fassin, in der Unternehmenszentrale in Emmerich schlossen die Teilnehmer:innen des Seminars „Nachhaltige Unternehmensführung in der Praxis“ von Prof. Dr. Wilhelm ihre Projektarbeit erfolgreich ab. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Katjes sollten die Anforderungen aus der Corporate Sustainability Reporting Directive, die die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen festlegt, herausgearbeitet werden.
Ziel des Seminars, das in Kooperation mit dem Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke angeboten wird, ist es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, praktische Problemstellungen im Kontext einer ökologisch und sozial nachhaltigen Unternehmensführung wissenschaftlich fundiert zu lösen. Neben Kenntnissen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements trainieren die Studierenden ihre Fähigkeiten im Bereich der qualitativen Datenerhebung, -auswertung und -präsentation. Nicht zuletzt bietet das Seminar hervorragende Möglichkeiten zum Aufbau eines persönlichen Netzwerks. Prof. Wilhelm resümiert: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Katjes erneut einen prominenten Kooperationspartner für unser Seminar gewinnen konnten und dass unsere Studierenden ihr Projekt auch aus Sicht des Unternehmens mit großem Erfolg abgeschlossen haben.“
Wir bedanken uns bei Katjes für die Einladung nach Emmerich und freuen uns sehr über das erfolgreiche gemeinsame Projekt.
Seit 2021 arbeitet die Universität Witten/Herdecke mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an dem gemeinsamen Forschungsprojekt AMARIS. Ziel des Projektes ist die Verbesserung organisationsübergreifender Teamarbeit im maritimen Such- und Rettungsdienst, für den die DGzRS auf Nord- und Ostsee zuständig ist.
Die Zukunft der Suche und Rettung auf See, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, neue Herausforderungen für die überwiegend freiwilligen Besatzungsmitglieder der DGzRS und die Bewältigung schwieriger Einsätze sind nur einige der Themen, die auf dem XXIV. World Maritime Rescue Congress 2023 in Rotterdam vom 18. bis 20. Juni einen Platz gefunden haben. Der Kongress findet alle vier Jahre statt und bringt Seenotrettungsdienste aus aller Welt zusammen. Bei praktischen Demonstrationen von Seenotrettungseinsätzen, Hubschrauberflügen und zahlreichen Panels zu Themen rund um die Arbeit engagierter Crews findet ein reger und enger internationaler Austausch statt.
Anika Sprakel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des RMI und Teammitglied im Forschungsprojekt AMARIS, stellte das Projekt im Rahmen des Panels „New Technologies for Training and Learning“ vor. Ihr Vortrag arbeitete das Ziel des Projektes – die Schaffung einer Simulationsumgebung, um komplexe Großschadenslagen auf See zu trainieren – und das Vorgehen des Projektverbundes heraus. So sollen mit AMARIS die Seenotretter und Hubschrauberbesatzungen auf eine noch engere Zusammenarbeit bei der Rettung von Passagieren und Besatzungsmitgliedern von Schiffen unter schwierigen Wetterbedingungen vorbereitet werden. Dazu werden das Simulatorzentrum der DGzRS in Bremen und der Hubschraubersimulator im Simulatorzentrum AVES (Air Vehicle Simulator) des DLR in Braunschweig miteinander vernetzt. Durch diese Kopplung können die Besatzungen seegehender und fliegender Einheiten ihre Koordination trainieren und so in komplexen Szenarien noch effizienter agieren. Die Professur für Strategische Organisation (Prof. Dr. Wilhelm) am RMI hat hierfür gemeinsam mit den Verbundpartnern ein Schulungskonzept entwickelt. Darüber hinaus evaluiert die Professur systematisch die Wirksamkeit des Trainings. Im Austausch mit anderen Kongressteilnehmenden wurde insbesondere die von AMARIS adressierte Forschungslücke und der innovative, transdisziplinäre Ansatz zu ihrer Lösung positiv aufgenommen.
AMARIS startet im September in die finale Phase, in der erstmals Teilnehmer:innen das Trainingsprogramm durchlaufen werden.
‚Welche Eigenschaften sollte eine Führungskraft mitbringen? Macht Vielfalt in den Chefetagen alle zufriedener? Braucht es überhaupt Führungskräfte?‘ – diese Fragen erörterten Eva Röder vom SWR2 im Rahmen eines Radiointerviews am 06. Juni 2023 mit Guido Möllering (RMI), Maren Lehky (Führungskräftecoach) und Stephan Heiler (Geschäftsführer einer Glasmanufaktur).
Das gesamte Radio-Interview können Sie hier in der SWR Mediathek abrufen.
Welche Vorstellung von Führungsqualitäten bereits Reinhard Mohn (Namensgeber des RMIs und wichtiger Unterstützer der Universität Witten/Herdecke) hatte und ihre Relevanz heute, erläutert Guido Möllering in einem vierseitigen Artikel in der Zeitschrift people&work 2/23 (Seite 26-29).
Mohns Arbeitsphilosophie beruhte u.a. darauf, dass die Arbeitnehmer:innen an Entscheidungsprozessen partizipieren sollen und sich so mit dem Unternehmen identifizieren und sich ihrer individuallen Beiträge und eigenen Verantwortung zum Erfolg und Wohl des Unternehmens bewusst sind. Eine Führungskraft müsste offen für solch eine Partizipation sein und dies aktiv fordern und fördern, eine Harmonisierung aller Interessen im Auge haben.
Dr. Francesca Ciulli (Universität Tilburg) und Dr. Leona Henry (UW/H) haben in einer hybriden Veranstaltung ihre aktuelle Forschung über die Nutzung digitaler Technologien in Multi-Stakeholder-Partnerschaften zur Bewältigung großer Herausforderungen den anwesenden Gästen im Raum sowie den via Zoom zugeschalteten Teilnehmern vorgestellt.
Es wird zunehmend erkannt, dass die "großen Herausforderungen" unserer Gesellschaft, wie Klimawandel, Armut oder der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, nur gemeinsam angegangen werden können. Infolgedessen sind mehrere Multi-Stakeholder-Partnerschaften entstanden, in denen organisatorische Akteur:innen aus verschiedenen Sektoren ihr Fachwissen und ihre Ressourcen bündeln, um solche komplexen gesellschaftlichen Fragen anzugehen. In jüngster Zeit haben Multi-Stakeholder-Partnerschaften begonnen, mit digitalen Technologien zu experimentieren, um ihren Auftrag zu erfüllen. In diesem Forschungsseminar diskutieren die Autor:innen das Zusammenspiel zwischen digitalen Technologien und Multi-Stakeholder-Partnerschaften, die versuchen, komplexe gesellschaftliche Probleme anzugehen.
Dr. Francesca Ciulli ist Assistenzprofessorin für Organization Studies/Global Management of Social Issues an der Universität Tilburg in den Niederlanden. Ihre Forschung konzentriert sich auf Organisationen und neue digitale Technologien in Bezug auf große Herausforderungen, Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung. Ihre Forschungsergebnisse wurden in Fachzeitschriften wie Journal of International Business Studies, Journal of Business Ethics, Journal of Management Studies und Environmental Innovation and Societal Transitions veröffentlicht.
Dr. Leona Henry ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Reinhard Mohn Institut (UW/H). In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf kollaborative Organisationsformen für Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung, wie Multi-Stakeholder-Initiativen und sektorübergreifende Partnerschaften. Ihre Arbeiten wurden in Fachzeitschriften wie Business & Society, Business, Strategy & the Environment und Management Revue-Socio economic studies veröffentlicht.
RMI Research Seminare bieten ein Forum für die Diskussion neuester Erkenntnisse in Forschungsbereichen, die mit denen des Reinhard Mohn Instituts für Management an der Universität Witten/Herdecke übereinstimmen oder diese ergänzen. Die Referent:innen sind in der Regel internationale Nachwuchswissenschaftler:innen und/oder interdisziplinär ausgerichtete Wissenschaftler:innen.
In 2018 war Elieti Fernandes für sieben Monate Gastwissenschaftlerin am RMI. Damals kam sie noch von der Unisinos Business School in Porto Alegre, inzwischen ist sie Professorin an der Universidade Federal do Rio Grande, Brasilien. Aus der damals begonnenen Kooperation mit Guido Möllering vom RMI ist nun ein Artikel im Project Management Journal erschienen mit dem Titel: „Governance of Interorganizational Projects: A Process-Based Approach Applied to a Latin American–European Case“.
Darin geht es unter anderem darum, wie relationale Faktoren wie Vertrauen in interorganisationalen Projekten dazu beitragen, die Destabilisierung der Governance-Konfiguration im Falle unerwarteter Ereignisse zu kompensieren. Alle Projekte haben gewisse Turbulenzen, aber in diesem lateinamerikanisch-europäischen Netzwerk zur Erforschung der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten waren einige Störungen des Projekts ziemlich schwerwiegend, wie zum Beispiel der Tod eines führenden Projektbeteiligten. Mit einem prozessbasierten Ansatz trägt die Studie zu einer dynamischen Theorie des sog. Relational View und einem netzwerk-governance-basierten Verständnis von Projektmanagement bei, was insbesondere in Kontexten hoher Unsicherheit praktisch relevant ist.
Die Publikation ist für Prof. Fernandes und das RMI eine schöne, bleibende Erinnerung an den Gastaufenthalt an der Universität Witten/Herdecke.
Zum Auftakt des Jahres 2023 haben wir uns sehr gefreut, Dr. Michael Beier (Schweizerisches Institut für Entrepreneurship) als Gast in unserem hybriden RMI Research Seminar am 23. Januar.2023 hier auf dem Campus und via Zoom begrüßen zu dürfen.
Dr. Beier hat den rund 20 Teilnehmer:innen seine aktuellen Forschungsergebnisse zu der Frage „Wie unterscheiden sich Geschlechter in ihrem kollaborativen Startup-Verhalten?“ vorgestellt. In einer detaillierten Untersuchung von Plattformdaten aus dem reward-based Crowdfunding deckt er Unterschiede im und Implikationen aus dem kollaborativen Startup-Verhalten von Frauen und Männern auf, die zum Teil bisher nicht beobachtbar waren.
Am 15. November hielt Dr. Becky Stiles, Head of Sustainability, Personal Care bei BASF für die Emea Region, einen Gastvortrag über Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette von Körperpflegeprodukten. In ihrem Vortrag, der Teil des Masterseminars "Strategizing Corporate Social Responsibility" im Rahmen des Studiengangs Strategy & Organization war, ging sie auf verschiedene Themen ein, die in diesem Prozess wichtig sind, darunter Partnerschaften für Nachhaltigkeit, nachhaltige Beschaffungsstrategien sowie die Herausforderung, CO2 Emissionen zu senken. Mit ihrem Vortrag gab Dr. Becky Stiles den Studierenden und interessierten Gästen einen detaillierten Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategie eines multinationalen Unternehmens wie der BASF. In ihrem Vortrag betonte sie mehrfach die Relevanz von Kooperationen im Kontext von nachhaltiger Unternehmensführung, was auch ein wichtiger Themenschwerpunkt im Seminar ist.
Unternehmensführung unter VUCA Bedingungen: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt
Aktuell findet eine ungewöhnliche Ballung folgenschwerer Ereignisse und Entwicklungen statt, die nicht nur Unternehmen, sondern alle vor bedeutende Herausforderungen stellen. Mark Ebers stellte in der RMI Distinguished Lecture dar, unter welchen Bedingungen es Unternehmen gelingen kann, ihren Weg in einer VUCA-Welt durch strategische Voraussicht und Anpassung, Agilität und Flexibilität erfolgreicher zu gestalten.
Im Anschluss an den Vortrag gab es nach einem Kommentar von Günther Ortmann die Gelegenheit für die etwa 70 Teilnehmer zur angeregten Diskussion. Die Veranstaltung fand im neuen Veranstaltungssaal des Neubaus der UW/H statt und wurde von Hendrik Wilhelm (RMI) moderiert.
Zur Person: Professor Ebers promovierte an der Universität Mannheim bei Alfred Kieser und habilitierte sich dort. Er hatte bis 2022 den Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensentwicklung und Organisation an der Universität zu Köln inne und ist Mitglied des Präsidiums und des Vorstands der Schmalenbachgesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. sowie des Fachkollegiums Wirtschaftswissenschaften der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Wir wissen, dass sich vieles ändern muss angesichts der multiplen und langanhaltenden Krisen unserer Zeit. Dazu gehört auch unsere vorrangige Wirtschaftsweise, mit der weiterhin primär ökonomische Ziele verfolgt werden, ohne die teilweise katastrophalen Wirkungen auf die Gesellschaft und den Planeten zu berücksichtigen. Doch wie kann eine andere Art des Wirtschaftens, die sich an alternativen moralischen Werten wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Umweltbewahrung ausrichtet, überhaupt aussehen? Es finden sich bereits zahlreiche Beispiele für Organisationen und Gemeinschaftsinitiativen, die Wirtschaft anders betreiben, indem sie ihr Handeln primär an diesen Werten orientieren, so bspw. gemeinwohlorientierte und postwachstumsorientierte Unternehmen, solidarökonomische Organisationen, Genossenschaften, und Transition Town-Initiativen. Organisationen und Gemeinschaftsprojekte wie diese leben bereits heute alternative Wirtschaftsweisen und zeigen damit, dass Visionen alternativer Zukünfte tatsächlich realisierbar sind. Daher gelten sie auch als wichtige Bausteine einer fundamentalen sozialen Transformation unserer Art des Lebens und Wirtschaftens. In der Wissenschaft werden diese Organisationen und ihre Art des Organisierens zunehmend als präfigurativ bezeichnet. Doch was heißt das Präfiguration eigentlich genau? Und welche Rolle spielt präfiguratives Organisieren für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft?
Der jüngst erschienene Artikel von Simone Schiller-Merkens (RMI) behandelt diese Fragen genauer und zeigt dabei auch, dass präfiguratives Organisieren nicht konfliktfrei realisierbar ist. Er ist unter folgendem Link frei zugänglich https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13505084221124189
Klima, Krieg und Krankheiten sind zu einem erdrückenden Krisenkomplex geworden. Die These der Zeitenwende fordert uns heraus, die Zukunft zu gestalten. Wir brauchen Inspiration und Ideen, was getan werden kann. Wie können wir aktiv die Transformation voranbringen? Wie erreichen wir nachhaltig das ökologische, wirtschaftliche und soziale Überleben? Wie passt alles zusammen? Diese spannenden Fragen haben wir im Veranstaltungssaal unseres Neubaus mit etwa 100 Gästen diskutiert.
Wibke Brems MdL (Fraktionsvorsitzende GRÜNE NRW-Landtagsfraktion) bekam durchaus kritische Fragen aus dem Publikum und zeigte sich engagiert und offen, während die Historikerin Annette Kehnel (Universität Mannheim, Autorin des Bestsellers »Wir konnten auch anders«) spannende historische Referenzen zum Thema Nachhaltigkeit aufzeigte.
Während des Networking-Empfangs am Abend gab es außerdem einen „Zukunftstalk", bei dem wir Tobias Esch (Universität Witten/Herdecke), Brigitte Mohn (Bertelsmann Stiftung), Annette Kehnel und Katharina Weghmann (EY) unter anderem nach Vorbildern in diesen unsicheren Zeiten gefragt haben. Zwischen Mutter Teresa und dem Anti-Vorbild Elon Musk gab es keinen Mangel an inspirierenden Ideen.
Einen Veranstaltungsbericht mit weiteren Details und Fotos finden Sie hier .
Der »RMI Tag der Unternehmensführung 2022« setzt die Tradition früherer Symposien fort und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu wichtigen Themen, die Führungskräfte, Forschende, Studierende und die Gesellschaft insgesamt bewegen.
Traditionell wird in der Ukraine am 6. Juli die Sommersonnenwende gefeiert – mit entsprechenden Gerichten, Handwerkskünsten, Blumenkränzeflechten usw.
Studierende des Seminars “Managing War” (Current Issues in Value-Based Management) von Guido Möllering haben zusammen mit ihren Ukrainischen Gast-Kommiliton:innen sowie deutschen und ukrainischen Gästen aus Witten und Umgebung im Garten der Uni Witten/Herdecke die Tradition des Mittsommerfests „Ivana Kupala“ aufleben lassen und Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Neben der Verkostung traditioneller Gerichte wurde Kunst aus der Ukraine dargeboten und es gab die Möglichkeit, wunderschöne Blumenkränze zu flechten – die dann später dem Brauch entsprechend im Wasser versenkt wurden. Musikalisch untermahlt wurde der sehr stimmungsvolle Abend mit Musik von DJ Vykrutka.
Bernadette Bullinger (IE University, Business School, Madrid) presented an ongoing research project that focuses on migrant shop owners and their employees and their practices facing disturbances and various boundaries, such as cultural and special boundaries.
Boundary work – as individuals and collectives’ efforts to create, blur, or transform boundaries between groups – is crucial for our understanding of how actors, especially those who are migrants, navigate their social spaces and handle disturbances. Boundary work might take place at the complex intersection of different boundaries, which in its complexity has so far received little academic attention. It is however crucial for navigating disturbances. The ability to remain functioning in the face of disturbances is called resilience, which is also a key aspect of the United Nations’ Sustainable Development Goals. In the RMI Research Seminar, Bernadette presented a study for which she and her co-authors conducted 83 interviews focused on migrant business actors in an inner city and multi-cultural neighbourhood.
Bernadette Bullinger is an assistant professor at IE University. Specializing in Organization Studies and Human Resource Management, her research touches on frontline workers, migration and questions of legitimacy in the context of career and recruitment—in addition to visual and multimodal methods of studying organizations and work. Bernadette has published articles in a range of journals such as Organization Studies, Journal of Management Inquiry, British Journal of Management and others.
RMI Research Seminars provide a forum for discussing latest findings in research areas matching or complementing those of the Reinhard Mohn Institute of Management at Witten/Herdecke University. Speakers are usually international, early-career and/or interdisciplinary-minded researchers.
Evidenz zur Wirksamkeit von Praktiken ist in der Medizin und in der Wirtschaft eine gesuchte Grundlage für Entscheidungen. In beiden Feldern ist Evidenz auch ein Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis. Doch lassen sich Fakten und Vermutungen in der Managementforschung nach dem Vorbild der Evidence-Based Medicine trennen, wie es der Begriff Evidence-Based Management nahelegt?
Diese Frage erörterten bei der von Hendrik Wilhelm (RMI, Universität Witten/Herdecke) moderierten Debatte Alfred Kieser (Universität Mannheim), Nicole Skoetz (Universitätsklinik Köln) und Michael Frese (u.a. Leuphana-Universität Lüneburg, National University of Singapore) mit etwa 50 Teilnehmern.
Einen Veranstaltungsbericht mit Fotos und Details zu den Referent:innen finden Sie hier .
Maryna Kuzhel von der Nationalen Wirtschaftsuniversität Kyiv ist von Mai bis Juli 2022 am Reinhard-Mohn-Institut zu Gast. Wir freuen uns auf den Austausch mit ihr zu Organisations- und Managementthemen vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, aber auch darüber hinaus.
Frau Kuzhel ist Associate Professorin im Business Economics and Entrepreneurship Department ihrer Universität. Als promovierte Ökonomin arbeitet sie zu Themen wie Entscheidungsverhalten, Marketing, Krisenmanagement und Unternehmensgründung. Sie hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Hochschullehre.
Seit ihrer Flucht vor dem Krieg lebt sie mit ihren Kindern bei einer Familie in Witten. Als Gastwissenschaftlerin bringt sie sich in die Aktivitäten der Fakultät für Wirtschaft- und Gesellschaft ein und hält zum Beispiel am 11. Mai im Rahmen des Moduls „Managing War“ im B.Sc. Management-Studiengang einen Vortrag darüber, was der Krieg für Firmen in der Ukraine bedeutet (ab 12:00 Uhr, Raum 1.172b).
Wir heißen Prof. Kuzhel herzlich an der UW/H willkommen und laden alle Interessierten ein, sich mit ihr fachlich und persönlich auszutauschen im Sinne der Solidarität und Völkerverständigung.
Birthe Soppe, Philip Balsiger and Simone Schiller-Merkens presented research on moral market entrepreneurs, their social change agendas and imaginaries of the future.
What is the impact of crises on moral market entrepreneurs who attempt to shape future society and create value for it through their market engagement? Fundamental crises, like the current pandemic, present an enormous backlash for markets but can also open up windows of opportunity for a more fundamental social transformation.
In this hybrid RMI research seminar the presenters Birthe Soppe , Assistant Professor of Business Administration with a focus on Organisation (University of Innsbruck), Philip Balsiger , Professor of Economic Sociology (University of Neuchâtel), and Simone Schiller-Merkens , Habilitand at the Reinhard Mohn Institute of Management (Witten/Herdecke University) discussed with the participants in the room as well as those online how moral market entrepreneurs as important drivers in the socio-ecological transformation of the economy perceive and evaluate the role of crises for their own market activism.
Eine spannende interdisziplinäre Tagung zum Thema „Organisation und Mythos“ hat vom 17. – 19. 3. 2022 in Marburg stattgefunden, in Kooperation des RMI mit der Universität Siegen, konzipiert und kuratiert von Prof. Dr. Thomas Klatetzki (Uni Siegen) und Prof. Dr. Günther Ortmann (RMI).
Hochkarätige Beteiligte waren u. a. Dirk Baecker (UW/H), Alfred Kieser (Uni Mannheim), Anja Mensching (Uni Kiel), Elke Weik (University of Southern Denmark, Sonderborg) und Stephan Wolff (Uni Hildesheim). Einen Glanzpunkt der drei Tage steuerte Prof. Dr. Maria Moss bei, Literaturwissenschaftlerin von der Leuphana Universität Lüneburg – mit einer Keynote zu „Blumenbergs ‚Arbeit am Mythos‘ als Ästhetik der Entängstigung“.
Tolle Beiträge kamen auch von den übrigen Gästen – hier finden Sie die komplette Auflistung aller Vortragstitel.
Eine inhaltliche Rahmung erhielt die Tagung durch einen einleitenden Vortrag von Günther Ortmann mit dem Titel „Organisation als Höhle. Die Bleibe des Mythos in der Organisationstheorie“ und einen abschließenden Beitrag von Thomas Klatetzki: „Imagination, Metaphern und Mythen: Die metaphysische Konstitution der Organisation in ‚make believe games‘“. Den Reiz der Tagung machten Spannungen aus: die zwischen Roland Barthes‘ und Hans Blumenbergs Begriff des Mythos, zwischen einer eher positiven und einer eher pejorativen Konnotation des Mythosbegriffs und schließlich zwischen der Lesart „Organisationen (und die Organisationstheorie) zehren von Mythen“ (Ortmann) und der radikaleren, „Organisation ist ein Mythos, Resultat von ‚make believe games‘“ (Klatetzki).
Mit Baecker, Locher, Möllering und Ortmann war die Universität Witten/Herdecke stark vertreten. Es ist geplant, die Beiträge, eventuell ergänzt um weitere Texte, in einem Sammelband zu veröffentlichen.
Zum 01. Juni 2022 verstärken wir das AMARIS-Team des RMI mit einer/einem ambitionierten Wissenschaftlichen Mitarbeiter:in (WMA), die/der sich mit ihren/seinen Fachkenntnissen und Ideen aktiv in das AMARIS-Projekt einbringt. AMARIS ist ein gemeinschaftliches Projekt der RMI Professur für Strategische Organisation mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Das Projekt befasst sich mit inter-organisationaler Teamarbeit und der Entwicklung von Schulungskonzepten für modernste Einsatzsimulatoren.
Chirurginnen und Chirurgen operieren gemeinsam dann am schnellsten, wenn sie eine geringe zwischenmenschliche Anspannung erleben; andere zwischenmenschliche Emotionen wie Entspanntheit, Nervosität oder Trägheit spielen keine wesentliche Rolle: Das ist ein Ergebnis einer Studie von Prof. Dr. Hendrik Wilhelm (RMI) gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der University of Toronto, der Business School INSEAD und der Hochschule Hannover, die jetzt in der international renommierten Zeitschrift Academy of Management Discoveries veröffentlicht wurde: https://journals.aom.org/doi/10.5465/amd.2018.0095.
Die Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen verschiedenen zwischenmenschlichen Emotionen, die die Operateure in ihrer Zusammenarbeit erleben, und der Zeit, die sie zur Durchführung der Operation benötigen. „Bei Operationen ist zwischenmenschliche Anspannung anscheinend besonders problematisch, denn bei einem chirurgischen Eingriff kommt es auf die Feinabstimmung zwischen den Operateuren an. Wir haben herausgefunden, dass Anspannung zwischen Operateurinnen und Operateuren diese Abstimmung erschwert. Die Operateure sind dann zurückhaltender in ihrer Kommunikation und dann dauert der Eingriff länger“ erläutert Prof. Wilhelm.
Zum Inhalt der Studie gibt es auch ein Erklärvideo unter: https://journals.aom.org/doi/video_original/10.5465/amd.2018.0095/amd.2018.0095_Whiteboard_Video_AMD_8.1.mp4
Eine neue Auswertung des Führungskräfte-Radars 2021 des RMI in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung gibt Anlass zur Sorge, dass Gender- und Gleichstellungsthemen in Unternehmen nicht konsequent weiterentwickelt werden. Wie in der nun veröffentlichten Studie „Zwanglos gendern? “ dargestellt, sind Führungskräfte in Deutschland gespalten, wenn es um verpflichtende Maßnahmen wie Quoten geht, und sie scheinen den Eindruck zu haben, dass wenig Handlungsbedarf besteht.
Es scheint eine große Diskrepanz zwischen den öffentlichen Diskursen und der Wahrnehmung der eigenen Unternehmen durch deren Führungskräfte zu geben. Überraschenderweise nehmen weibliche und männliche Führungskräfte Themen wie Quoten, Diskriminierung, gendergerechte Sprache und Umgang mit sexueller Belästigung ähnlich wahr – und zwar als überwiegend unproblematisch.
„Gleichstellung ist kein Selbstläufer“, meint Professor Guido Möllering vom RMI. „Das Problembewusstsein ist gering und es gilt, sowohl Gängelung als auch Gleichgültigkeit zu vermeiden.“ Gewisse signifikante, aber nur leichte Unterschiede lassen sich zwischen den Führungsebenen, Generationen, Unternehmensgrößen erkennen.
Weitere Informationen, Implikationen, Grafiken und Befunde sind in dem Papier „Zwanglos gendern?“ enthalten, dass zum kostenlosen Download bereitsteht. Aktuell wird unter anderem im Stern und Handelsblatt über die Studie berichtet.
Um nachhaltige Innovationen zu verwirklichen, arbeiten Akteure häufig in Innovationsnetzwerken zusammen, die von einem Netzwerk-Manager koordiniert werden. Obwohl die meisten dieser Innovationsnetzwerke eher dynamisch und schnelllebig sind, untersucht die Studie "Sluggish, but innovative? Orchestrating collaboration in multi-stakeholder networks despite low commitment", erschienen im Journal Innovation: Organization & Management, einen empirischen Fall, in dem die Netzwerk-Mitglieder anfangs nicht sehr engagiert sind, während die Netzwerk-Manager selbst sehr aktiv und motiviert sind.
In dieser qualitativen Studie zeigen Leona Henry und Guido Möllering (beide RMI) die Herausforderungen auf, mit denen sich Netzwerk-Manager in diesen "trägen" Netzwerken konfrontiert sehen. Darüber hinaus zeigt die Studie drei Praktiken auf, die Manager anwenden, um das Engagement der Mitglieder zu fördern. Auf der Grundlage der Ergebnisse erweitert diese Studie das allgemeine Verständnis von Netzwerkmanagement indem sie Praktiken aufzeigt, die sich speziell auf die Motivation zu mehr Engagement bei Netzwerkmitgliedern konzentrieren, die zwar generell interessiert sind, aber zunächst passiv bleiben. Da sich viele Innovationsnetzwerke durch eine solche Dynamik auszeichnen, hat die Studie wichtige praktische und theoretische Implikationen für die Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit im Kontext nachhaltiger Innovation.
Den vollständigen Artikel findet man hier: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14479338.2022.2029707
Für mehr Nachhaltigkeit müssen sehr unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten. Das ist eine Herausforderung, vor allem wenn einerseits eine breite Beteiligung gewünscht ist und andererseits auch erwartet wird, dass die Kooperation effizient abläuft. Zu diesem Thema haben Leona Henry und Guido Möllering vom RMI mit Andreas Rasche von der Copenhagen Business School in der Zeitschrift „Business & Society“ eine neue Studie veröffentlicht. Sie zeigen darin unter anderem, dass es für die Zusammenarbeit hilfreich sein kann, die verschiedenen Akteure nicht alle gleich zu behandeln und immer alle gleichzeitig und gleichermaßen zu involvieren, sondern teils auch zu differenzieren. Allerdings kann die Paradoxie der Inklusion und Effizienz dabei nicht beseitig werden. Sie bleibt ein besonderer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, damit Nachhaltigkeitsinitiativen erfolgreich sein können. Hier geht es zu dem Artikel
Autos, Spülmaschinen, Fahrräder – viele Hersteller können derzeit nicht liefern, weil wichtige Teile fehlen. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Beschaffungsprozesse unter solchen Wettbewerbsbedingungen leistungsfähig bleiben? Eine Antwort darauf liefert eine Studie, die unter Beteiligung von Prof. Dr. Hendrik Wilhelm, Inhaber der RMI Professur für Strategische Organisation, entstanden ist: „Dynamische Fähigkeiten helfen, Betriebsabläufe – wie bspw. Beschaffungsprozesse – wettbewerbsfähig zu halten. Wir haben vier Idealtypen solcher Fähigkeiten identifiziert, die jeweils nur unter ganz bestimmten Bedingungen funktionieren“, fasst die Ergebnisse einer Studie zusammen, die er gemeinsam mit Prof. Dr. Indre Maurer (Georg-August-Universität Göttingen) und Prof. Dr. Mark Ebers (Universität zu Köln) verfasst hat. Sie ist jetzt unter dem Titel „(When) are dynamic capabilities routine? A mixed-methods configurational analysis“ in der Fachzeitschrift Journal of Management Studies erschienen.
Unternehmen verfügen über dynamische Fähigkeiten, wenn sie regelmäßig Aktivitäten ausführen, um wichtige Veränderungen im Umfeld zu erkennen, die Auswirkung auf das eigene Unternehmen zu analysieren und dann gegebenenfalls zielgerichtete Veränderungen der bestehenden Betriebsabläufe auszulösen. Nicht alle Unternehmen verfügen über solche Fähigkeiten, zudem gibt es erhebliche Unterschiede, wie Unternehmen die zugrundeliegenden Aktivitäten organisieren. „Manche Unternehmen führen diese Aktivitäten wie ein Programm aus, mit hoher Frequenz – beinahe wöchentlich –und strengen Verfahrensvorgaben, andere Unternehmen machen das sehr viel seltener und haben kaum Vorgaben. Alle diese Ansätze können funktionieren. Die Frage ist aber, unter welchen Umständen?“, so Prof. Wilhelm.
Wollen Sie mehr über dynamische Fähigkeiten wissen? Hier geht es zu dem Fachartikel
Und hier finden Sie den UW/H-Blogbeitrag, den die Autoren zur Studie verfasst haben (Januar 2022): https://blog.uni-wh.de/
Zum Frühjahr 22 verstärken wir das RMI Team mit einem:r ambitionierten Wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in (WMA), die/der sich mit ihren/seinen Fachkenntnissen und Ideen aktiv einbringt und die inhaltlichen Schwerpunkte des Instituts in der Organisations- und Managementforschung unterstützt.
Zu besetzen ist eine WMA-Stelle (zur Promotion i.d.R. mit 75% einer Vollzeitstelle; PostDoc/Habilitation verhandelbar). Sie arbeiten direkt mit dem Institutsdirektor Professor Möllering zusammen. Die Einstellung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet für bis zu drei Jahre.
Die Bewerbungsfrist endete am 31. Januar 2022 und ist bereits besetzt!
Einen intensiven, kollegialen Austausch zu laufenden Forschungsprojekten zum Thema „Vertrauen“ gab es bei einem Workshop des RMI, den wir aus Anlass des längeren Gastaufenthalts von Joe Hamm von der Michigan State University bei uns organisiert haben.
Alle Beteiligten brachten Work-in-Progress mit, gaben einander konstruktives Feedback und konnten wertvolle Einblicke und Hinweise mitnehmen. Dabei zeichnete die Gruppe sich durch eine große Vielfalt aus: 14 Teilnehmende, acht Nationalitäten, diverse Fachdisziplinen. Die Alters- und Karriere-Spannbreite reichte von Wittener Bachelorstudierenden bis zum renommierten Emeritus Bart Nooteboom (Uni Tilburg), der am Vorabend des Workshops eine Keynote hielt.
Die Themen umfassten konzeptionelle Fragen – Vertrauen und Verwundbarkeit, Moral, Metaphern, Misstrauen u.a. – wie auch empirische Untersuchungen zum Beispiel zu Innovationsnetzwerken, Verhandlungsführung, Bildungssystemen und politischen Institutionen. Häufig ging es darum, besser zu verstehen, als es die die bisherige Forschung leistet, was genau Vertrauenswürdigkeit bedeutet und wie sie im Einzelnen erkannt und konstruiert wird.
Virtuelle Trainings unter widrigen Wetterbedingungen mit Schiffen und Hubschraubern tragen dazu bei, Menschen in Seenot schneller und sicherer zu helfen. Ziel des gemeinsamen AMARIS-Workshops am 20. und 21. Oktober 2021 an der Universität Witten/Herdecke war es, Grundlagen für ein Schulungskonzept zur Verbesserung solcher Trainings zu schaffen.
Das AMARIS-Team des RMI — Professor Hendrik Wilhelm, Tim Szczygielski und Eiko Gerten — gemeinsam mit Vertreter:innen der AMARIS-Projektpartner Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) als Verbundkoordinator und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie des Kooperationspartners Aeronautical Rescue Coordination Centre der Deutschen Marine in Glücksburg schufen hierfür in einem Workshop die Grundlagen. „Das AMARIS-Schulungskonzept soll festlegen, innerhalb welcher Rahmenparameter welche Lernziele erreicht werden sollen sowie welches Wissen und welche Fertigkeiten hierzu Kursteilnehmer:innen vermittelt werden müssen“, so Hendrik Wilhelm, der das AMARIS-Teilprojekt an der Universität Witten/Herdecke leitet. Um diese Inhalte zu erarbeiten, nutzten Tim Szczygielski und Eiko Gerten verschiedene Gruppendiskussionsverfahren und Brainstormingmethoden, um gemeinsam mit den Workshopteilnehmer:innen das Leitziel, Grobziele, Feinziele sowie theoretische Wissens- und praktische Fertigkeiteninhalte, mit viel Enthusiasmus an der Sache, herauszuarbeiten.
Ziel des durch Mittel des BMBF geförderten Projektes AMARIS ist, die Suche und Rettung Schiffbrüchiger durch gemeinsame, organisationsübergreifende Simulatortrainings der Seenotretter auf Nord- und Ostsee sowie ihrer fliegenden Kollegen zu verbessern. Dafür entwickelt die für den maritimen Such- und Rettungsdienst in unseren Gebieten von Nord- und Ostsee verantwortliche DGzRS mit dem DLR und dem RMI eine einzigartige Trainings- und Forschungsumgebung.
Das AMARIS-Team des RMI bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit im Rahmen des Workshops und darüber hinaus. Das nächste Arbeitstreffen unter Beteiligung des RMI wird in wenigen Wochen am DLR-Standort Braunschweig stattfinden.
Zum 100. Geburtstag Reinhard Mohns lud das nach ihm benannte Institut zum Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein, um Themen zu reflektieren, die Mohn am Herzen lagen und die auch heute noch Führungskräfte, Forschende und die Gesellschaft bewegen. Zum „RMI Tag der Unternehmensführung 2021“ ist auch das vom RMI in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung (BSt) herausgegebene Buch „Was heißt unternehmerische Verantwortung heute? Reflexionen zum 100. Geburtstag Reinhard Mohns“ erschienen (ISBN 978-3-86793-940-9).
Eine Berichterstattung mit Fotos, Videos und Informationen zu den Referent:innen finden Sie hier .
Das Team des RMI freut sich sehr über die Ankunft von Joe Hamm, der während seines Sabbaticals von Anfang September bis Ende Dezember 2021 zu Gast am RMI ist.
Joseph A. Hamm ist Associate Professor an der School of Criminal Justice der Michigan State University , USA und ist Doctor of Philosophy in Psychology. Er forscht zusammen mit Guido Möllering, Instituts-Leiter des RMI, interdisziplinär an verschiedenen Vertrauens-Themen.
Durch Gastaufenthalte dieser Art kommt die internationale Ausrichtung des RMI zum Ausdruck und wird lebendig.
A very warm welcome, Joe, to the RMI and Witten!
Wir gratulieren Günther Ortmann, Inhaber der Professor für Führung am Reinhard-Mohn-Institut, ganz herzlich zur Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr. rer. pol. h. c.) durch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen.
Prof. Dr. Dr. h.c. Günther Ortmann wurde diese besondere Ehrung für seine herausragenden Beiträge zu den Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen und der Organisationsforschung im Speziellen zuteil. Mit der Universität Siegen verbindet Professor Ortmann eine langjährige Zusammenarbeit bei der Förderung der Pluralen Ökonomie in Forschung und Lehre. Auf Einladung des Dekans der Fakultät, Prof. Dr. Marc Hassenzahl, sowie des Geschäftsführers der Marco Durissini, verfolgten über 60 Wissenschaftler*innen aus dem deutschsprachigen Raum die Zeremonie am Bildschirm.
Nach einer Begrüßung durch den Dekan würdigte Prof. Dr. Alfred Kieser – Professor Emeritus der Universität Mannheim und Gastprofessor am RMI - in seiner Laudatio „Können und Haben, Geben und Nehmen. Kompetenzen als Ressourcen – zu Günther Ortmann.“ Leben, Forschung und Werk seines ersten Doktoranden Günther Ortmann.
In seinem Festvortrag „Für eine heterodoxe Theorie der Unternehmung. Plädoyer mit einer Mücke, einem Löwen, einer Henne, einem Elephanten und lauter Schildkröten“ ging Günther Ortmann dann mit Humor und Scharfsinn auf aktuelle Entwicklungen in der Theorie der Unternehmung ein.
Hierzu auch noch eine aktuelle Meldung der Universität Witten/Herdecke vom 26. Juli 2021.
Vom 8. bis 10. Juli 2021 trafen sich Organisationsforscherinnen und -forscher auf der jährlichen Konferenz der European Group for Organizational Studies (EGOS). Die Tagung, welche eigentlich in Amsterdam geplant war, fand diesmal online statt. Das Reinhard-Mohn-Institut war mit verschiedenen Beiträgen an der Konferenz beteiligt:
Tina Azad und Guido Möllering (beide RMI) nahmen am Track „May you live in interesting times: trust dynamics in changing contexts“ teil, von welchem Guido Möllering auch der Convenor war. Tina Azad (Doktorandin) präsentierte ein Paper (mit Guido Möllering) dazu, wie Dritte trotz Unsicherheiten Vertrauensaufbau und Kooperation in Innovationsnetzwerken unterstützen. In diesem Track war auch Elieti Biques Fernandez (Universidade Federal do Rio Grande), ehemalige Gast-Wissenschaftlerin am RMI. Sie präsentierte (zusammen mit Guido Möllering und Douglas Wegner (Unisinos Universität)) ein Paper zur Rolle von Vertrauen und zwischenmenschlichen Beziehungen beim Organisieren einer effektiven Governance in inter-organisationalen Projekten.
Leona Henry (Habilitandin) nahm am Track “MSIs: Inclusive dynamics to address grand challenges” teil. Leona Henry präsentierte dabei ein aktuelles Forschungspapier (mit Guido Möllering) zur Koordination von Innovationsnetzwerken im Nachhaltigkeitskontext.
Simone Schiller Merkens (Habilitandin) präsentierte im Track "Moral Markets: Actors, Meanings, and Institutions" ein Paper (gemeinsam mit Philip Balsiger (Universität Neuchâtel) und Birthe Soppe (Universität Innsbruck)) zum Thema „Real Utopias in Times of Crises: How the COVI-19 Pandemic Affects Moral Market Entrepreneurs‘ Imaginaries of the Future“.
RMI-Mitarbeiterin Dr. Simone Schiller-Merkens hat ihre aktuellen Forschungsarbeiten zuletzt in verschiedenen Veranstaltungen zur Diskussion gestellt. Den Auftakt machte im Juni 2021 ein Vortrag zum Thema "Organizing Toward an Alternative Economy: Prefigurative Social Movements and Alternative Organizing", zu dem sie vom Institute for Social Innovation der ESADE Business School in Barcelona eingeladen wurde. Der Vortrag fand im Rahmen eines Workshops statt, der sich mit moralischen Märkten und alternativen Organisationsformen im Zeitalter der Digitalisierung beschäftigte (online hier verfügbar, ab Minute 40:00).
Anfang Juli 2021 folgten Präsentationen zum Thema "Real Utopias in Times of Crises: How the COVID-19 Pandemic Affects Moral Market Entrepreneurs' Imaginaries of the Future" im Rahmen des 33rd SASE Annual Meeting und des diesjährigen EGOS Colloquium. Gemeinsam mit Philip Balsiger (Universität Neuchâtel) und Birthe Soppe (Universität Innsbruck) betrachtet sie in diesem Projekt die Bedeutung von Krisen (Klimawandel, Pandemie) für die Zukunftsvorstellungen und Wandelambitionen moralischer Unternehmer.
Anlässlich des SASE Annual Meeting wurde schließlich auch ein Manuskript zum Thema "Knowing Food: Food Policy Councils and the Politics of Expertise" vorgestellt. Gemeinsam mit Amanda Machin (Universität Witten/Herdecke) diskutiert sie am Beispiel von Ernährungsräten die Herausforderungen des Wissenstransfers in Organisationen, in denen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gemeinschaftlich alternative Formen des Wirtschaftens gestalten wollen.
Während des laufenden Sommersemesters 2021 und zum Wintersemester 2021/2022 verstärken wir das RMI Team mit STUDENTISCHEN HILFSKRÄFTEN (w/m/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst die aktive Unterstützung bei laufenden Forschungsprojekten, insbesondere beim AMARIS-Projekt, aber auch bei Lehrveranstaltungen sowie die Mitwirkung bei der Lehrstuhlarbeit. Als Mitglied des RMI-Teams erhalten Sie interessante Einblicke in wissenschaftliche Fragestellungen u.a. mit Bezug zu Management- und Organisationstheorien, Netzwerk- und Allianzstrategien sowie Vertrauen in und zwischen Organisationen. Zudem besteht die Möglichkeit, an spannenden Praxisprojekten in einem jungen, dynamischen Team und einem motivierenden Arbeitsumfeld mitzuwirken.
Weitere Details hier.
Über 50 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichsten Bereichen haben sich zusammen mit uns mit der Frage beschäftigt „Was heißt unternehmereiche Verantwortung?“ Wir konnten uns an wichtige Gedanken dazu von Reinhard Mohn, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, erinnern und vor allem auch dank des inspirierenden Vortrags von Prof. Dr. Andreas Rasche über die historische und zukünftige Entwicklung der Verantwortung und Nachhaltigkeit von Unternehmen intensiv diskutieren.
Die Veranstaltung war als öffentlicher Teil einer Sitzung des RMI-Kuratoriums konzipiert, dem Liz Mohn, Dr. Brigitte Mohn, Dr. Ralph Heck, Dr. Immanuel Hermreck, Prof. Dr. Martin Butzlaff, Prof. Dr. Erik Strauß, Dr. Heike Schütter und Dr. Katharina Weghmann angehören. Grußworte und einführende Anmerkungen aus dem Kuratorium und von RMI-Direktor Prof. Dr. Guido Möllering stimmten auf den Vortrag von Prof. Dr. Rasche und die anschließende Diskussion mit allen Gästen ein.
Zur Person: Andreas Rasche ist Professor of Business in Society am CBS Centre for Sustainability und Associate Dean des CBS Full-Time MBA Programms an der Copenhagen Business School. Er promovierte an der EBS Business School und habilitierte sich an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Mit hochkarätigen Veröffentlichungen und u.a. auch als ehemaliges Mitglied des United Nations Global Compact LEAD Steering Committees gehört er zu den ausgewiesenen Experten in den Feldern Corporate Sustainability, nachhaltiges Investieren und der politischen Rolle von Unternehmen.
Zum 100. Geburtstag Reinhard Mohns in 2021 trägt das nach ihm benannte Institut mit einer Festschrift und Veranstaltungen zu Themen bei, die dem Unternehmer und Stifter am Herzen lagen.
Eine Aufzeichnung des RMI Online Forums finden Sie hier .
Menschen aus Seenot zu retten ist Teamarbeit, auf und über See gleichermaßen. Damit die Seenotretter auf Nord- und Ostsee und ihre fliegenden Partner im Einsatz erfolgreich sind, trainieren sie ständig die Zusammenarbeit. Um auch virtuell gemeinsam üben zu können, entwickelt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem RMI eine einzigartige Trainings- und Forschungsumgebung.
Ziel des im März 2021 gestarteten Forschungsprojekts Aeronautische und maritime Innovationsumgebung für interorganisationale Simulationen (AMARIS) ist es, dass die Seenotretter die Suche und Rettung Schiffbrüchiger künftig gemeinsam mit Hubschrauberbesatzungen organisationsübergreifend in ihrem SAR-Simulator (SAR = Search and Rescue) trainieren, auch wenn sich andere Teilnehmer an weit entfernten Orten befinden. Dazu soll das Simulatorzentrum der DGzRS in Bremen mit dem Air Vehicle Simulator (AVES) des DLR in Braunschweig gekoppelt werden.
„Seenotretter und Hubschrauber-Crews sollen standardisierte Einsatzverfahren, aber auch Notmanöver und kritische Situationen im Simulator trainieren“, sagt Rolf Detlefsen, Leiter des Simulatorzentrums der DGzRS. Dort werden die Seenotretter und Wachleiter (SAR Mission Co-ordinator) der SEENOTLEITUNG BREMEN (MRCC = Maritime Rescue Co-ordination Centre) in den international einheitlichen und verbindlichen SAR-Verfahren trainiert.
Eigens installierte neue Sensoren in den Simulatoren werden physiologische Daten messen, um zu erforschen, wie Simulatortrainings insgesamt wirken. Sie sammeln Daten, um organisationsübergreifende Teamarbeit besser zu verstehen. Die Erkenntnisse sollen in ein wissenschaftlich fundiertes Schulungskonzept fließen. Die Forscher um Prof. Dr. Hendrik Wilhelm, Inhaber der RMI-Professur für Strategische Organisation, werden konkrete Ansätze zum Wissens- und Erfahrungstransfer in Simulatortrainings entwickeln. „Uns interessiert, was Teams dazu befähigt, über Organisationsgrenzen hinweg erfolgreich zusammenzuarbeiten. Dabei spielen nicht nur formale Strukturen und Prozesse eine wichtige Rolle. Wichtig ist auch das zwischenmenschliche Zusammenspiel“, sagt Hendrik Wilhelm.
Die im AMARIS-Projekt entwickelte Forschungs- und Trainingsumgebung wird über die zweijährige Projektlaufzeit hinaus bestehen bleiben und das Schulungskonzept fortlaufend verbessern. Für das SAR-Simulatorzentrum der Seenotretter liefert das Vorhaben neben verbesserten Trainingsbedingungen eine einzigartige Laborumgebung für verhaltens- und organisationswissenschaftliche Forschungsfragen zur Menschenrettung auf See.
Eugenia Rosca von der Universität Tilburg präsentierte Forschungsergebnisse aus einer Studie, die zeigt wie verschiedene Intermediäre die Nachhaltigkeit in Base of the Pyramid (BOP) Lieferketten unterstützen können. Dr. Rosca und ihre internationalen Co-Autoren haben in einem Forschungsprojekt in Kolumbien herausgefunden, dass BOP-Unternehmen auf vier Wegen wirtschaftliche und soziale Lebensfähigkeit erreichen können: Formalisierung, Legitimität für gefährdete Stakeholder, Entwicklung von Sozialkapital und Erwerb von ergänzenden Ressourcen durch ein erweitertes Netzwerk von Intermediären.
Ursprünglich aus Moldawien/Rumänien stammend, ist Dr. Eugenia Rosca Assistenzprofessorin für Supply Chain Management und akademische Direktorin an der Universität Tilburg, Niederlande, sowie Gastdozentin an der Universidad Externado de Colombia. Sie promovierte 2018 an der Jacobs Universität Bremen. Ihre Forschungsinteressen drehen sich um Nachhaltigkeitsaspekte in Lieferketten und industriellen Systemen, mit besonderem Fokus auf Entwicklungsländer und Base of the Pyramid Märkte.
Die RMI-Research Seminare bieten ein Forum für die Diskussion neuester Erkenntnisse in Forschungsbereichen, die mit denen des Reinhard-Mohn-Instituts übereinstimmen oder diese ergänzen. Die Referenten sind in der Regel internationale Nachwuchswissenschaftler und/oder interdisziplinär ausgerichtete Forscher. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Seminare derzeit online über Zoom abgehalten.
Den Link mit der Aufzeichnung des Online Research Seminars finden Sie hier .
For Englisch information click here
Weitere RMI Online Research Seminare in 2021:
Am 17. Juni 2021 diskutierte Prof. Anne Gausdal (Kristiana Universität) mit rund 40 Gästen zum Thema "Managing Networks "
und am 15. Juli 2021 findet ein weiteres RMI Online Research-Seminar mit Prof. Hannah Trittin-Ulbrich (Leuphana Universität) zum Thema "Digitalisierung und Organisation" statt.
Im Rahmen des Bachelor-Moduls „Governance“ im B.Sc. Management finden drei Praxisvorträge statt, die aktuelle Beispiele und praktische Bezüge zu den Kooperationsformen „Make, Buy & Cooperate“ näherbringen sollen.
Gestartet wurde am 10. Mai mit einem Gastvortrag von Armin Decker, Prokurist und Betriebsleiter bei J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, der erläutert hat, wie bei dem alteingesessenen Wittener Familienunternehmen die interne Produktion nach dem Konzept des Lean Managements umstrukturiert wurde und wie genau die Implementierung dabei stattgefunden hat. J.D. Neuhaus ist der weltweit führende Hersteller für pneumatische & hydraulische Hebezeuge, Krananlagen und Systemlösungen.
Am 07. Juni 2021 schildert Jochen Mannsperger, Prokurist beim Fruchtsafthersteller Amecke, seine Erfahrungen mit klassischen Fragen des Supply Chain Managements und geht dabei auch auf aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie und das nachhaltige Wirtschaften ein. Die Amecke GmbH & Co. KG mit Sitz in Menden (Sauerland) ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das mit seinen innovativen Produkten zu den Top 3 Fruchtsaftmarken in Deutschland gehört. Das Obst und Gemüse für die Säfte werden mit hohem Qualitätsanspruch aus der ganzen Welt beschafft.
Dr. Frank Lerch, Geschäftsführer bei Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V., gibt am 12. Juli 2021 praktische Einblicke in das Netzwerkmanagement des Kompetenznetzes. Er geht dabei auf die Funktionen des Netzwerkmanagements sowie auf aktuelle Entwicklungen des Vereins ein. OpTecBB e.V. ist das Kompetenznetz für optische Technologien Mikrosystemtechnik in den Ländern Brandenburg und Berlin. Der Verein wurde im Jahre 2000 von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Verbänden gegründet und zählt heute ca. 120 institutionelle Mitglieder.
Die Gastvorträge von Jochen Mannsperger und Dr. Frank Lerch sind für alle Interessierten offen und starten jeweils um 10 Uhr. Nach Anmeldung an rmi@uni-wh.de erhalten Sie die Zoom-Zugangsdaten.
Vom 29.-30.4.2021 fand die Online-Tagung "The 'Betrieb' (organization, firm, firm's establishment) as corporate actor - a theoretical and empirical challenge" statt, veranstaltet von Dorothea Allewell (Universität Hamburg) und Wenzel Matiaske (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg). Das Thema ist wichtig nicht zuletzt wegen der Frage, ob Unternehmen als ökonomische, aber auch rechtlich und moralisch verantwortliche Akteure gelten können und sogar müssen.
Die Tagung war hochkarätig besetzt. Es nahmen u. a. teil: Kirsten and Nicolai Foss (Copenhagen Business School), David Marsden (London School of Economics), Walter W. Powell (University Stanford) und Dieter Sadowski (Universität Trier).
Für das RMI war Günther Ortmann mit einem Vortrag "On Elias Khalil's 'Is the firm an individual?' " vertreten. Khalil, in Deutschland nicht so bekannt wie viele Vertreter der neuen institutionellen Ökonomik (NIÖ), etwa Ronald Coase und Oliver Williamson, zählt zu den scharfsinnigsten Vertretern einer theoretischen Ökonomik jenseits des Mainstreams und hat in seinem Beitrag dargelegt, dass Unternehmen korporative Akteure mit einem "common, consented goal" und eigenen Interessen sind. Dieses für ihn entscheidende Kriterium zur Unterscheidung von Märkten und anderen loseren Netzwerken einerseits und Unternehmen andererseits werde von der NIÖ verfehlt. Ortmann stellte Khalils Ansatz und seine NIÖ-Kritik vor und fügte eigene Ergänzungen und Kritikpunkte hinzu, vor allem eine Problematisierung (und dann doch nicht völlige Zurückweisung) des heiklen Konsensbegriffs Khalils.
Innovative Führungsarbeit ist gefragt, um bei Homeoffice und Krisenmanagement in Pandemie-Zeiten kollegiale Entkopplung zu verhindern. Bei diesem Online-Event am 15. April 2021 haben über 50 interessierte TeilnehmerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen hierzu Studienergebnisse der Bertelsmann Stiftung und des Reinhard-Mohn-Instituts für Unternehmensführung (RMI) erörtert.
Der aktuelle Führungskräfte-Radar zeigt: Das Krisenmanagement in den Organisationen wird positiv bewertet und Homeoffice funktioniert meist gut. Allerdings wünschen sich viele Führungskräfte und ihre Mitarbeiter:innen, baldmöglichst wieder im Büro arbeiten zu können. Denn auf Dauer wird es zum Problem, wenn man sich weniger austauschen und unterstützen kann. Was aber tun, wenn Homeoffice noch eine ganze Weile nötig bleibt und auch zukünftig zumindest ein Teil der Kolleg:innen teilweise nicht im Büro arbeitet?
Prof. Dr. Guido Möllering und Sabrina Schuster vom RMI haben als Hintergrund die Zahlen des Führungskräfte-Radars vorgestellt. Martin Spilker, Direktor des Kompetenzzentrums „Führung und Unternehmenskultur“ der Bertelsmann Stiftung kommentierte die Ergebnisse. Im Anschluss ergab sich eine reger Erfahrungsaustausch und eine angeregte Diskussion unter den Teilnehmenden.
Den Live-Mitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf diesem YouTube-Kanal .
Zum Sommersemester 2021 verstärken wir das RMI Team mit ambitionierten Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen (w/m/d), die sich mit ihren Fachkenntnissen und Ideen aktiv einbringen. Wir bieten Ihnen ein inspirierendes und kollegiales Umfeld für Ihr Promotions- oder Habilitationsvorhaben, das die inhaltlichen Schwerpunkte des Instituts in der Organisations- und Managementforschung unterstützt.
Wir möchten insgesamt zwei Projektstellen besetzen, die bedarfsgerecht in Teilzeit aufgeteilt werden können (Promotionsstellen i.d.R. 50 %, max. 75%). Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für bis zu drei Jahre zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Als Mitglied des RMI-Teams engagieren Sie sich im Rahmen des Forschungs- und des Lehrprogramms des Instituts. Hierbei tragen Sie auch zu einem gemeinschaftlichen Projekt der RMI-Professur für Strategische Organisation mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (www.seenotretter.de) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (www.dlr.de) aktiv bei. Das Projekt befasst sich mit inter-organisationaler Teamarbeit und der Entwicklung von Schulungskonzepten für modernste Einsatzsimulatoren. Auch unterstützen Sie den Praxisdialog des Instituts. Ihre Themenschwerpunkte in Forschung und Lehre werden individuell herausgearbeitet.
Weitere Details hier
Anmerkung: die Stellen sind mittlerweile besetzt
Insgesamt 67 Teilnehmende haben sich am 09. Dezember 2020 um 18:00 Uhr auf Einladung des RMI und der Hochschulgruppe Witten (bdvb e.V.) beim Gastvortrag von Dipl.-Kfm. Christian von Daniels zum Thema „Mask have! Wie van Laack das Beste aus der Conora-Krise macht“ zugeschaltet. Der Geschäftsführer des Textilherstellers reflektierte, wie die van Laack GmbH mit der Pandemie umgeht, zum größten Masken-Produzenten Deutschlands wurde, jüngst aber auch Kritik erlebt.
Nicht nur die Studierenden, sondern auch Führungskräfte, Beratende und Journalist:innen diskutierten im Anschluss daran sehr rege über Krisenmanagement in höchst außergewöhnlichen Zeiten.
Hier dazu ein WAZ-Bericht und der YouTube-Mitschnitt zur Veranstaltung.
Sie stärken die Region mit innovativen Ideen, sie schaffen zum Beispiel digitale Plattformen für gemeinschaftliches Wohnen, und sie machen Lieferketten nachhaltig. Dafür werden sechs Unternehmen belohnt: Sie sind Preisträger des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel“ 2020. Zum neunten Mal zeichnen die Bertelsmann Stiftung, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, DIE JUNGEN UNTERNEHMER und das Reinhard-Mohn-Institut der Universität Witten/Herdecke nachhaltig-wirtschaftende und gesellschaftlich engagierte Unternehmen aus.
Per Videobotschaft, aber nicht weniger herzlich gratuliert die Jury den vorbildlichen Unternehmen: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Silicon Vilstal gUG, Patchwork Communities UG (bring-together.de), Followfood GmbH, Deutsche Amphibolin Werke (DAW) SE und Johann Herges GmbH. Weil in der Corona-Krise der gesellschaftliche Zusammenhalt mehr als alles andere zählt, hat die Jury in diesem Jahr einen Sonderpreis „Starke Region – starke Gemeinschaft“ ausgelobt.
Prof. Dr. Guido Möllering vom RMI war wieder Mitglied der Jury und verkündet in der Videobotschaft die beiden Preisträger in den Kategorien „Klein- und mittelständische Unternehmen“ sowie „große Unternehmen“. Er würdigt insbesondere, dass Followfood und DAW nicht nur einen ökologisch-nachhaltigen, sondern auch einen partnerschaftlichen Ansatz verfolgen. Prof. Möllering: „Unternehmerische Verantwortung erfordert es immer mehr, mit anderen zusammenzuarbeiten.“
Einzelheiten zum Wettbewerb und allen Preisträgern auf der Website mein-gutes-beispiel.de und bei der Bertelsmann Stiftung.
Im Rahmen des Masterseminars "Strategizing Corporate Social Responsibility" von Dr. Simone Schiller-Merkens haben am 11. November 2020 über 25 Seminar- und externe Teilnehmer an einem gut 90-minütigen Online-Vortrag von Ariane Piper zum Thema Einblicke und Möglichkeiten von Kampagnenarbeit: Für mehr Verantwortung und Transparenz in der Modeindustrie per Zoom teilgenommen.
Ariane Piper ist eine absolute Expertin für nachhaltige(re) Mode und beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven Themen wie Produktionsbedingungen, Konsum und Handlungsmöglichkeiten. Sie arbeitet als Projekt Managerin für die Green Fashion Tours, als Länderkoordinatorin für Fashion Revolution Deutschland bei future fashion forward e.V., als Multiplikatorin für FEMNET e.V., und ist als freie Speakerin für Nachhaltigkeit in der Textilindustrie tätig.
Als Multiplikatorin für FEMNET e.V. hat sie mit den Seminar-Teilnehmern über die Möglichkeiten der Kampagnenarbeit für bessere Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie gesprochen und dies anhand der Beispiele von FEMNET und der Clean Clothes Campaign verdeutlicht, sowie über die Herausforderungen von Siegeln und Transparenz zur Steuerung von - üblicherweise globalen - Wertschöpfungsprozessen diskutiert.
Darauf aufbauend fand am 18.11.2020 ein interner Workshop statt, in dem Frau Piper mit den Studierenden die Glaubwürdigkeit und Transparenz ausgewählter Textilsiegel beleuchtet hat.
In Kooperation der Universität Siegen, der Alfred Toepfer Stiftung und dem RMI fand auf Gut Siggen in Schleswig-Holstein eine interdisziplinäre Tagung zum Thema „Organisation und Imagination“ statt, konzipiert und organisiert von Prof. Dr. Thomas Klatetzki, Universität Siegen und Prof. Dr. Günther Ortmann, RMI. Für viele war es die erste Präsenz-Tagung seit Langem, in kleinem Kreis und mit den nötigen Corona-Vorkehrungen. Drei der Vorträge mit anschließender Diskussion wurden via Zoom realisiert.
Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus der Betriebswirtschaftslehre, der Organisationssoziologie, -psychologie und -pädagogik, der Kulturwissenschaft, der Mediensoziologie, der Filmwissenschaft, der Psychoanalyse, den Literaturwissenschaften und der Philosophie. Günther Ortmann, Forschungsprofessor am RMI, sprach über „Theorieszenen der Organisationstheorie“, Guido Möllering, RMI-Institutsdirektor, über „Imaginierte Zielkonsistenz als Grundlage von Vertrauen in und zwischen Organisationen“.
Auf Konzepte und Denkfiguren wie Gareth Morgans Images of Organization, Fiktionen des Organisierens, Symbole, Metaphern, story telling, Bild, Image u. a. fiel überraschend neues Licht, als sie aus jeweils unterschiedlichen fachdisziplinären Perspektiven beleuchtet wurden – praktizierte Interdisziplinarität nicht im Sinne systematischer Integration, sondern wechselseitiger Inspiration.
Zum Wintersemester 2020/21 verstärken wir das RMI Team mit STUDENTISCHEN HILFSKRÄFTEN (w/m/d). Als Mitglied des RMI-Teams erhalten Sie interessante Einblicke in wissenschaftliche Fragestellungen, u.a. mit Bezug zu Management- und Organisationstheorien, Netzwerk- und Allianzstrategien sowie Vertrauen in und zwischen Organisationen. Zudem besteht die Möglichkeit, an spannenden Praxisprojekten in einem jungen, dynamischen Team und einem motivierenden Arbeitsumfeld mitzuwirken.
Weitere Details hier.
Anmerkung: Die Stellen sind mittlerweile besetzt.
Auch die mit mehr als 18.000 Mitgliedern weltweit größte Vereinigung von Forscherinnen und Forschern im Bereich Management musste ihre Jahreskonferenz online abhalten, statt wie geplant in Vancouver. Vom 7.-11. August 2020 wurden viele Live-Sessions geboten, ein Großteil der Beiträge aber auch asynchron mit aufgezeichneten Videos und anderen Materialien und Diskussionsmöglichkeiten bereitgestellt.
Das RMI freut sich, dass insgesamt vier im Januar eingereichte Forschungspapiere im Review-Verfahren zur Präsentation beim Academy of Management Meeting angenommen und auf der AOM Plattform unter der entsprechenden Session Nummer vorgestellt wurden.
Neben der Präsentation aktueller Forschungsarbeiten sind Professional Development Workshops ein wichtiger Bestandteil des AOM Programms. In diesem Jahr war Hendrik Wilhelm in diesem Vorprogramm der Konferenz Teil des Workshops “For a Limited Time Only: A Practice-Based View of Strategizing in Temporary Organizations“ (Session 529). Ziel des Workshops war es, Forscherinnen und Forscher zusammenzubringen, um praxistheoretische Perspektiven auf temporäre Organisationen (wie bspw. Projekte oder Allianzen) und temporäres Organisieren zu diskutieren. Der Workshop geht auf einen Sammelband der Reihe Research in the Sociology of Organizations zurück, in dem Hendrik Wilhelm - zusammen mit Indre Maurer und Clarissa Weber (Universität Göttingen), Suleika Bort (Universität Passau) und René Abel (VTG AG) - mit einem Beitrag zur temporalen Dynamik von Allianzportfolios vertreten ist.
Leona Henry, inzwischen Assistant Professor an der University of Tilburg, stellte zwei Beiträge aus ihrem abgeschlossenen RMI-Promotionsprojekt vor. Erstens in Session 811 „Coping with the Inclusiveness-Efficiency Paradox in Cross-Sector Partnerships“ mit Andreas Rasche (Copenhagen Business School) und Guido Möllering (RMI). Zweitens in Session 1039 “Orchestrating Interstitial Networks: Dynamics of High-potential, Low-expectation Collaboration” mit Guido Möllering. Übergreifendes Thema beider Papiere ist der Umgang mit Spannungsverhältnissen im Verlaufe von Kooperationsbeziehungen.
Seit längerer Zeit arbeitet Guido Möllering mit Simon Schafheitle und Antoinette Weibel von der Universität St. Gallen an einer Studie darüber, dass es ganz verschiedene Wege gibt, wie Führungskräfte Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln. Mit dem Beitrag “How Leaders Develop Trust in High Trust Organizations - Many Routes to Active Trusting” in Session 1190 wurde Simon Schafheitle als Finalist für den MOC Division Best Student-led Paper Award nominiert.
Schließlich war Hendrik Wilhelm in Session 1222 mit Ergebnissen aus einem laufenden Forschungsprojekt vertreten, aus dem er auch Teile im Rahmen seiner Antrittsvorlesung an der UW/H vorgestellt hatte: “When Do Incumbents Identify Entrants as Competitors?“ in Koautorenschaft mit Klemens Klein und Sascha Albers (Universität Antwerpen). Die Studie verknüpft verhaltenswissenschaftliche Forschung zu Teams mit Erkenntnissen aus der Strategieforschung um besser zu verstehen, warum etablierte Unternehmen häufig neue Wettbewerber übersehen und damit Wettbewerbsnachteile erfahren.
„Wir freuen uns, dass das RMI auch in diesem Jahr mit seiner Forschung bei diesem wichtigen Event sehr stark sichtbar ist“, meint Guido Möllering, und Hendrik Wilhelm fügt hinzu: „Auch virtuell bietet die AOM einen wichtigen Raum, um sich mit Kolleginnen und Kollegen intensiv über aktuelle Forschung auszutauschen.“
Alle Details zur Konferenz hier:
Zum Wintersemester 2020 verstärken wir das RMI Team mit ambitionierten Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen (w/m/d), die sich mit Ihren Fachkenntnissen und Ideen aktiv einbringen. Wir bieten ein inspirierendes und kollegiales Umfeld für Promotions- oder Habilitationsvorhaben, die die inhaltlichen Schwerpunkte des Instituts in der Organisations- und Managementforschung unterstützen.
Zu besetzen sind insgesamt bis zu zwei Vollzeitstellen, die bedarfsgerecht auch in Teilzeit besetzt und aufgeteilt werden können (Promotionsstellen i.d.R. 75%). Die Einstellung erfolgt befristet für bis zu drei Jahre zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Anmerkung: Die Stellen sind mittlerweile besetzt.
Im Rahmen des diesjährigen, virtuellen Annual Meeting der Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE ) war Simone Schiller-Merkens, Senior Researcher am RMI, mit zwei Beiträgen vertreten, einerseits im Forschungsnetzwerk "Alternatives to Capitalism", andererseits innerhalb der Minikonferenz "Possible Worlds: Practice, Ethics, Hope and Distress".
In ihren Präsentationen "Scaling up Alternatives to Capitalism: A Social Movement Approach to Alternative Organizing" und "Pathways towards Possible Worlds: A Social Movement Approach to Social Transformation" erörterte sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Frage, wie und unter welchen Bedingungen alternative Formen der Organisation wirtschaftlicher Austauschprozesse in der Gesellschaft Verbreitung finden und so zu einer sozial-ökologischen Transformation unseres Wirtschaftssystems beitragen können.
„Manager zweifeln an Tech-Kompetenz“, lautet die Überschrift des Artikels in Capital (Heft 7/2020, S. 13), der über eine spezielle Auswertung des Führungskräfte-Radars 2019 mit Blick auf Innovationen und Digitalisierung in Deutschland berichtet. Prof. Dr. Guido Möllering und Sabrina Schuster vom RMI arbeiten in dem Projekt mit der Bertelsmann Stiftung zusammen. Die allgemeine Auswertung zeigte bereits, dass viele Führungskräfte an der eigenen Rolle (ver-)zweifeln. Wenig Optimismus ist nun auch speziell zum Thema digitale Transformation zu vermelden, was Anlass zur Sorge geben könnte, dass an wichtigen Schnittstellen in deutschen Unternehmen Innovationsimpulse gedämpft statt verstärkt werden. „Denn eine Führungskraft, die selbst noch im Dunklen tappt, ist auch nicht diejenige, die ein Thema besonders vorantreibt“, zitiert Capital Prof. Möllering auch online.
Aus Sicht des RMI gilt es, Führungskräfte stärker zu unterstützen und neue, kollektivere Führungsformen zu etablieren. Besonders der Führungsnachwuchs sieht großen Nachholbedarf in Deutschland und wünscht sich ein anderes, weniger heroisches Führungsverständnis. Weitere Studienergebnisse und Interpretationen sind in einer zum Reinhard-Mohn-Preis 2020 erschienenen Publikation der Bertelsmann-Stiftung nachzulesen. Beim Roundtable zum Reinhard-Mohn-Preis am 17. Juni 2020 mit dem Preisträger Nechemia Peres wurde u.a. gefragt, welche Voraussetzungen es braucht, damit das innovative Potenzial in Deutschland gerade in Corona-Zeiten besser genutzt werden kann. Prof. Möllering argumentierte als Teilnehmer dazu, dass neben technologischen und politischen Bedingungen die sozialen Dynamiken der Transformation verstanden und vor allem Führungskräfte in ihrer Motivation und Kompetenz gestärkt werden müssten.
Prof. Möllering diskutierte die Frage „Scheitern Digitalisierung und Innovationen an den Führungskräften?“ auch bei einer Online-Dialogveranstaltung der Vereinigung deutscher Führungskräfteverbände ULA (United Leaders Association) am 18. Juni 2020. Die Studienergebnisse gaben den Anlass, Gründe für die negativen Einschätzungen der Befragten zu finden und Implikationen abzuleiten. Wie schon die übergreifenden Erkenntnissen des Führungskräfte-Radars nahelegten, gilt es auch beim Thema Innovation und Digitalisierung darum, bessere Bedingungen für eine zeitgemäße Führungsarbeit zu schaffen, um „Raus aus den Frustrationsspiralen“ zu kommen, wie es im Titel eines Beitrags von Prof. Möllering in Wirtschaftspsychologie aktuell (Heft 2/2020, S. 33-36) zum Themenschwerpunkt Reinventing Leadership heißt.
Weitere Auskünfte zu den Publikationen und zur Studie gerne unter rmi@uni-wh.de
In der renommierten Fachzeitschrift „Industry and Innovation“ wurde ein Artikel von Guido Möllering mit seinen norwegischen Koautoren Helge Svare und Anne H. Gausdal veröffentlicht. Basierend auf empirischen Fallstudien wird die Bedeutung verschiedener Aspekte des Vertrauens in Innovationsnetzwerken untersucht. Noch wichtiger als Kompetenz und Integrität ist insgesamt das wahrgenommene Wohlwollen (engl. benevolence) für die Entstehung von Vertrauen, das wiederum Kooperationen und Innovationen befördert. Die Autoren zeigen außerdem unterschiedliche Dynamiken der Vertrauensentwicklung der Beteiligten in das Netzwerk als Ganzes und zwischen einzelnen Mitgliedern untereinander. Für die Arbeit in Innovationsnetzwerken bietet der Artikel wichtige Hinweise, wie in verschiedenen Phasen und je nach aktuell relevanten Risiken bestimmte Akzente in der Vertrauensentwicklung gesetzt werden sollten.
Link zum Artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2019.1632695
Oft wird eine starke, einheitliche Kultur propagiert, aber erfordert die Komplexität und Dynamik der heutigen Zeit nicht vielmehr eine vielfältige Unternehmenskultur? Was muss in Unternehmen getan werden, nicht zuletzt von Führungskräften, damit die Vielfalt produktiv werden kann? Wie hat sich hierzu in der Wissenschaft der Blick auf Unternehmenskulturen weiterentwickelt? Wie soll man mit Konzepten wie „Agilität“ umgehen, die einen starken Kulturwandel einzufordern scheinen?
Hierzu haben sich hochkarätige Referentinnen und Referenten mit dem Publikum auf Einladung des Reinhard-Mohn-Instituts am "RMI Tag der Unternehmensführung" ausgetauscht und darüber diskutiert, wie stark vielfältige Unternehmenskulturen sind. Auf die Grußworte und ersten inhaltlichen Impulse von Heike Schütter und Martin Spilker folgte die Keynote von Sonja Sackmann, einer der auch über den deutschsprachigen Raum hinaus führenden Wissenschaftlerinnen zum Thema Unternehmenskultur, insbesondere Subkulturen und kulturelle Komplexität. Danach stellte RMI-Direktor Guido Möllering die neue Publikation „Vielfalt in Unternehmenskulturen“ (ISBN 978-3-86793-881-5 ) in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung vor, die Führungskräften eine Grundlage geben will, Kultur als „Werkzeugkasten“ zu verstehen und die eigene, vermittelnde Rolle anzunehmen.
Immanuel Hermreck, Personalvorstand der Bertelsmann SE, brachte sodann die Perspektive eines Konzerns näher, der bei aller Diversifizierung in seinen Geschäftsfeldern und einer vielfältigen, internationalen Belegschaft stets Wert auf seine „Essentials“ gelegt und diese jüngst aktualisiert hat. Ebenfalls praxisnah und zugleich in einem RMI-Forschungsprojekt fundiert, referierten Günther Ortmann und Clemens Wagner über neue, agile Arbeitsweisen in einem Automobilunternehmen, die dort quasi durch die Hintertür kamen und auf eine fest etablierte Bürokratie trafen. Hendrik Wilhelm betrachtete in seinem Ausblick dann die methodischen Herausforderungen, Kulturen in Ihrer Vielfalt angemessen zu erfassen, wenn man sie verstehen oder gar verändern will.
Die rund 80 Gäste aus Wirtschaft und Wissenschaft nutzten die Gelegenheit, sich in den Pausen aktiv und sehr angeregt an mehreren Diskussionsständen zu den Themen nochmal mit den Referenten, aber auch untereinander auszutauschen, sowie dabei auch die Aspekte anzusprechen, die sie in ihrem eigenen beruftlichen Umfeld diesbezüglich interessieren.
Einen kurzen Eindruck vom Tag erhält man mit einem Blick in das recap-Video , ausführlichere Informationen sowie alle Links zu den Vortrags-Videos findet man im Veranstaltungsbericht.
Der „RMI Tag der Unternehmensführung“ setzt die Tradition früherer Symposien fort und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu wichtigen Themen, die Führungskräfte, Forschende und Gesellschaft bewegen.
Zum 1. März 2020 wechselte Dr. Maximilian Heimstädt auf eine Stelle als Forschungsgruppenleiter ans Weizenbaum-Institut in Berlin. Das Weizenbaum-Institut erforscht interdisziplinär und grundlagenorientiert den Wandel der Gesellschaft durch die Digitalisierung und entwickelt Gestaltungsoptionen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Als Leiter der Forschungsgruppe "Reorganizing Knowledge Practices" wird sich Dr. Heimstädt mit neuen Organisationsformen der Wissensproduktion und -vermittlung auseinandersetzen. Beispielsweise befasst sich ein erstes Projekt der neuen Forschungsgruppe mit "Science Slams" als einer neuen Form der (Wirtschafts-)Wissenschaftskommunikation in Zeiten digitaler Öffentlichkeiten. Kooperationspartnerin dieses Projektes ist unter anderem RMI-Alumna Dr. Leona Henry (jetzt: Tilburg University).
Nach Abschluss seiner Promotion an der Freien Universität Berlin hat Dr. Maximilian Heimstädt im September 2016 seine Stelle als Postdoktorand am Reinhard-Mohn-Institut angetreten. "Am Reinhard-Mohn-Institut hatte ich die Möglichkeit an einem Verständnis von Unternehmensführung zu arbeiten, dass auf Vertrauen, Offenheit und die Fähigkeit zum Umgang mit Ungewissheit setzt" sagt Dr. Heimstädt. "Die Erfahrungen aus der engen Zusammenarbeit mit dem RMI-Team werden auch die Arbeitsweise meiner neuen Forschungsgruppe prägen".
Er war dreieinhalb Jahre an der Universität Witten/Herdecke angestellt. „In dieser Zeit hat er nicht nur äußerst erfolgreich publiziert und sich in öffentliche Debatten eingebracht, sondern auch Lehrveranstaltungen in Strategie und Organisation unterstützt und dabei Aspekte seiner Forschung zur Organisation von Expertise in Zeiten der Digitalität einfließen lassen,“ würdigt RMI-Direktor Guido Möllering den Beitrag von Dr. Heimstädt und freut sich, dass er dem RMI auch nach seinem Wechsel nach Berlin als Habilitand verbunden bleibt.
Das RMI-Team wünscht Maximilian Heimstädt einen guten Start und viel Erfolg am Weizenbaum-Institut!
Dass ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland an ihrer Rolle verzweifeln, ist der Aufhänger für die nun seitens der Bertelsmann Stiftung herausgegebene Pressemitteilung und einem kurzen Papier zum „Führungskräfte-Radar 2019“. Ein Großteil der Führungskräfte führt engagiert und sieht positive Wirkungen im eigenen Arbeitsbereich. Bei dem oft noch allzu heroischen Bild von „Leadership“ wird jedoch zu selten gesehen, dass Führungskräfte nicht nur andere motivieren, sondern gleichfalls motivierende und unterstützende Bedingungen für ihre Führungsaufgaben brauchen.
Dahinter steht ein gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung mit Guido Möllering und Sabrina Schuster vom RMI. Es wurden knapp 1.000 Führungskräfte befragt, wie sie ihre Führungsbedingungen, das eigene Führungsverhalten und diverse andere relevante Aspekte, darunter auch aktuell die Themen Digitale Transformation und Innovationsfähigkeit, wahrnehmen. Es ist geplant, jährlich eine ähnliche Umfrage durchzuführen. Die aktuellen Ergebnisse werden in den Medien sehr interessiert aufgenommen, zum Beispiel von Handelsblatt Online , Frankfurter Allgemeine Zeitung und dem Spiegel .
Gitta Neuhaus-Galladé hat als erste Absolventin den neuen Master of Science an der Universität Witten/Herdecke abgeschlossen.
Guido Möllering, Direktor am RMI und gleichzeitig verantwortlich für diesen Studiengang, freut sich, dass Gitta Neuhaus-Galladé der Karrierestart als Vorstandsreferentin bei der Comma Soft AG in Bonn nahtlos nach der Fertigstellung ihrer Masterarbeit, die er ebenfalls betreut hat, gelungen ist. Inzwischen hat sie auch ganz offiziell ihr Zeugnis als erste Absolventin des in 2018 in Witten neu gestarteten Masterprogramms „M.Sc. Strategy & Organization“ erhalten, wie die UW/H auf Ihrer Homepage berichtet (zur Pressemitteilung).
Bewerbungen für den M.Sc. Strategy & Organization werden jederzeit angenommen und bearbeitet. Der Studiengang richtet sich an Studierende, die bereits einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss haben und die unternehmerisch denken und ein Gespür für verantwortungsbewusste Entscheidungsprozesse entwickeln wollen − und zwar nicht nur unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung, sondern insbesondere unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen und vor dem Hintergrund globaler, ökonomischer, sozialer, kultureller und ethischer Gegebenheiten in Unternehmen und anderen, neuen Organisationsformen. Das RMI-Team bietet diverse Pflicht- und Wahlmodule in diesem Studiengang an.

(Foto: Ansichtssache_Britta Schröder/Bertelsmann Stiftung)
Die Bertelsmann Stiftung fördert für weitere sechs Jahre das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung (RMI) an der Universität Witten/Herdecke. Das RMI kann damit weiterhin zu Strategie, Organisation, Führung und unternehmerischer Verantwortung forschen und lehren.
„Wir freuen uns sehr über die weitere Kooperation, weil das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung Impulse zu Themen des Unternehmertums und des Managements verbunden mit gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme gibt, die schon meinem Vater wichtig waren und zukunftsweisend sind“, bekräftigt Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung und neue Vorsitzende des RMI-Kuratoriums, die Entscheidung.
„Dieser erneute Vertrauensbeweis bestärkt uns in unserem Anliegen, die Betriebswirtschaftslehre anschlussfähiger für die verantwortungsvolle Bearbeitung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu machen“, schaut Institutsleiter Prof. Dr. Guido Möllering nach vorne. „Dies tun wir mit neuen Projekten in Forschung, Lehre und Praxisdialog zum Beispiel über Vertrauen, Kooperation, Organisationskulturen und Führungsbedingungen in der heutigen Zeit.“
Die Vertragsverlängerung zwischen der Bertelsmann Stiftung und der Universität Witten/Herdecke wurde bei einer Kuratoriumssitzung unterzeichnet. Neu im RMI-Kuratorium begrüßt wurde bei diesem Anlass Katharina Weghmann, Partnerin bei Ernst & Young im Bereich Forensic & Integrity Services und damit eine ausgewiesene Expertin für viele RMI-Themen. Mit großem Dank verabschiedet wurde der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Aart De Geus.
In der renommierten Zeitschrift Organization Studies ist Günther Ortmanns Artikel "Novel Thought: Towards a Literary Study of Organization“ erschienen (Open Access). Neben dem RMI-Forschungsprofessor haben an dem Beitrag Prof. Timon Beyes (Leuphana Universität Lüneburg) und Prof. Jana Costas (Europa-Universität Viadrina) mitgewirkt. Im Aufsatz untersuchen die AutorInnen die wechselseitige Beeinflussung von Romanen und Organisationsforschung, beispielsweise anhand der Arbeiten von Franz Kafka und des zeitgenössischen Autors Tom McCarthy. Literarische Fiktion – so eine der zentralen Thesen des Aufsatzes – ermöglicht es uns Organisationen in Weisen zu erkennen, verstehen und auszumalen, die in der strengeren Form des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses keinen Platz finden. Der Aufsatz bildet gleichzeitig die Einleitung für einen Themenfokus mit dem Titel "The Novel and Organization Studies“ innerhalb der Zeitschrift Organization Studies. In diesem Abschnitt finden sich weitere Artikel, welche die Verbindung zwischen Organisationsliteratur und -forschung ausloten.
Zu diesem Thema hat Günther Ortmann (RMI Professor für Führung) zusammen mit Marianne Schuller (Professorin für Literaturwissenschaft und Dramaturgin) einen Kafka-Sammelband im Sommer 2019 herausgegeben, welcher am 23. Oktober bei einer Buchvorstellung an der UW/H vorgestellt wurde.
In einem Seminar des RMI untersuchten 12 Studierende der UW/H, wie sich der Wechsel des Standortes von Witten-Annen nach Dortmund-Oespel auf die verschiedenen Abteilungen bei der Dr. Ausbüttel & Co. GmbH ausgewirkt hat. Im Sinne des wissenschaftlich fundierten und zugleich anwendungsnahen Studiums an der UW/H wurde das Seminar „Strategie und Change Management“ diesmal erneut in Kooperation mit einem lokalen Unternehmen organisiert. Hierzu führten die Studierenden neben generellen Recherchen eine Reihe von Experteninterviews mit Mitarbeitern verschiedener Abteilungen durch. Bereits im Juli 2019 präsentierten die vier Gruppen vor der Geschäftsführung der Dr. Ausbüttel & Co. GmbH ihre vorläufigen Ergebnisse in dem neuen Gebäude am Dortmunder Standort. Die Studierenden stellten auf Basis ihrer Interviews dar, dass auch bei ansonsten weitgehend gleichbleibenden Arbeitsanforderungen und Rahmenbedingungen ein Standortwechsel viele Chancen und Risiken birgt. Partizipation und Kommunikation sind eine kontinuierliche und vielschichtige Aufgabe in organisationalen Veränderungsprozessen.
Nach den Präsentationen nahmen die Studierenden ihrerseits Feedback auf und arbeiteten ihre Ergebnisse noch detaillierter aus. Die Abschlussarbeiten wurden dann im Herbst an das Unternehmen gegeben. Janne Klar, Leiterin Human Resource Management & Soziales Engagement bei Dr. Ausbüttel, war sehr angetan von den Ergebnissen und bestätigt, dass die Hinweise der Studierenden im Unternehmen „einiges angestoßen“ haben. Kleingruppen arbeiten anhand der Ergebnisse des Projektseminars weiter an dem Thema und ergreifen konkrete Maßnahmen. Die Dozenten vom RMI, Guido Möllering, Clemens Wagner und Sabrina Schuster, freuen sich, dass die Studierenden sich die Fachkenntnisse zu organisatorischen Veränderungen nicht nur theoretisch aneignen, sondern auch ein reales Veränderungsszenario begleiten konnten.
Der Forschungsworkshop "Moral Critique in and around Markets: Organizing (for) Alternatives in Troubled Times", organisiert von Simone Schiller-Merkens (RMI) und Philip Balsiger (Université de Neuchatel), versammelte eine internationale Gemeinschaft von Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen - Organisationswissenschaften, Soziale Bewegungsforschung, Wirtschaftssoziologie, Politische Ökonomie, Rechts- und Geschichtswissenschaften -, um über die großen Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen und Wege zu diskutieren, wie man ihnen begegnen kann. Es wurden verschiedene Formen der alternativen Organisation vorgestellt, die auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen angesiedelt sind - beispielsweise Sozial- und Solidarwirtschaft, Postkapitalismus, moralische Märkten, direkte Produzenten-Konsumenten-Beziehungen, organisatorische Prozesse in und zwischen Sozialunternehmen und Genossenschaften.
Als Keynote-Speakers eröffneten Tim Bartley (Washington University, St. Louis), Francesca Forno (Universität Trento) und Ignasi Martí Lanuza (ESADE) verschiedene Einblicke in das Phänomen alternativer Organisation. Zahlreiche weitere Wissenschaftler aus dem In- und Ausland stellten ihre Perspektiven zur Diskussion.
Die Veranstaltung war die zweite in einer Reihe von Forschungsworkshops, die sich weitestgehend mit Fragen der Moral in der Wirtschaft befassen und in den nächsten Jahren an verschiedenen Orten und Kongressen, einschließlich der jährlichen Konferenzen von EGOS und SASE, fortgesetzt werden.
Elke Schüßler ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Vorständin des Instituts für Organisation an der Johannes Kepler Universität in Linz, Österreich. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel, menschenwürdiger Arbeit und der Digitalisierung.
Am 20. November hat sie im Rahmen eines RMI-Gastseminars einer Gruppe interessierter Wissenschaftler*innen und Student*innen ihren mit verschiedenen Kolleg*innen im August diesen Jahres veröffentlichten Bericht vorgestellt, der die Ergebnisse des Garment Supply Chain Governance Project zusammenfasst, welcher die gründlichste Analyse der aktuellen Praktiken von Bekleidungsherstellern und ihrer Auswirkungen auf Bekleidungsfabriken und Arbeitnehmer im Rahmen verschiedener öffentlicher und privater Initiativen zur Arbeitsorganisation bietet.
Die Katastrophe vom April 2013 in Bangladesch, bei der über 1.000 Textilarbeiter getötet und viele weitere verletzt wurden, hat die Welt erschüttert. Seitdem haben sich führende Unternehmen, Zulieferfabriken, Regierungen und zahlreiche andere Interessengruppen bemüht, die Gebäudesicherheit in Bangladesch zu verbessern und die Einführung von Arbeitsnormen in der Bekleidungslieferkette zu stärken.
Großer Tag am Reinhard-Mohn-Institut: am 23. Oktober 2019 hielt Prof. Dr. Hendrik Wilhelm, Inhaber der neuen RMI Professur für Strategische Organisation, um 16:00 Uhr im Audimax der Universität Witten/Herdecke vor rund 80 Gästen seine Antrittsvorlesung . Thema des Vortrags war: „Fiktion der Konkurrenz: Warum Unternehmen neue Marktteilnehmer nicht als relevante Wettbewerber erkennen“, der mit einer lebhaften Diskussion und einem kleinen Empfang endete, den die Teilnehmer als weitere Gelegenheit zum persönlichen Austausch nutzten.
Bei der sich anschließenden Buchvorstellung um 18:00 Uhr am selben Abend bot das RMI weitere Einblicke in seine Arbeit. Die beiden Herausgeber*innen Prof. Dr. Günther Ortmann und Prof. Dr. Marianne Schuller stellten mit Unterstützung des Literaturwissenschaftlers Prof. Dr. Manfred Schneider, Autor eines der Beiträge im dem Band, das Buch „Kafka. Organisation, Recht und Schrift“ vor. Dabei ist es den dreien gelungen, bei einem interdisziplinären Austausch das Publikum zu fesseln und zu inspirieren.
Hier geht es zu einigen Impressionen des Abends
Unternehmen können zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen entscheidend beitragen. Um die besten Projekte und Ideen sichtbar zu machen, startet die Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit „Die Jungen Unternehmer“, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und dem Reinhard-Mohn-Institut erneut den Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“. Die relevanten Themen sind vielfältig: Bildung und Ausbildung von jungen Menschen, Bekämpfung sozialer Ungleichheit, Umwelt- und Klimaschutz, Integration und Inklusion, lebenswerte Wohnräume, Vereinbarkeit von Beruf und privatem Leben, Kultur oder nachhaltige Mobilität. In allen Bereichen gibt es neue Ideen und innovative Ansätze von Unternehmen. Die besten davon werden ausgezeichnet.
Prof. Dr. Guido Möllering begleitet den Wettbewerb wissenschaftlich und ist Mitglied der hochkarätig besetzten Jury. Der RMI-Direktor sieht die Verantwortungsübernahme von Unternehmen nicht als Zusatzaufgabe, sondern als Teil der Unternehmensidentität: „Man muss nicht auf den Feierabend warten, um sich für die Gesellschaft zu engagieren, sondern kann – wie die ‚guten Beispiele‘ des Wettbewerbs zeigen – die Gemeinschaft und die Expertise im Unternehmen nutzen, um zur Lösung der großen Probleme beizutragen.“ Es gibt vier Preiskategorien für kleine und große Unternehmen, Handwerksbetriebe und den Bereich „Jung & innovativ“ (Start-up, Gründung, Nachfolge). Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2020 über www.mein-gutes-beispiel.de eingereicht werden.
Leona Henrys und Guido Möllerings Artikel „Collective Corporate Social Responsibility: The Role of Trust as an Organizing Principle” ist in der Zeitschrift Management Revue - Socio-Economic Studies erschienen. Ausgangspunkt des Beitrags ist die Erkenntnis, dass Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung besser in Kooperation mit anderen Unternehmen nachkommen können als alleine. Eine kollektive „CSR“ im Netzwerk sieht sich jedoch besonderen Herausforderungen gegenüber, vor allem der Gefahr, dass einige Beteiligte nicht ernsthaft an der Sache interessiert sind und sich entsprechend wenig einbringen. Henry und Möllering loten aus, inwieweit Vertrauen als Organisationsprinzip helfen kann, solche Herausforderungen zu meistern.
Link zum Artikel: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0935-9915-2019-2-3/mrev-management-revue-jahrgang-30-2019-heft-2-3
Der neue Band in der renommierten Reihe Research in the Sociology of Organizations (RSO) wurde von Simone Schiller-Merkens (RMI) und Philip Balsiger (Universität Neuchâtel) herausgegeben und ist nun veröffentlicht. Unter dem Titel "The Contested Moralities of Markets" bringt der Band unser aktuelles Verständnis unterschiedlicher, teils konfligierender Moralvorstellungen von Märkten zum Ausdruck. Er gewährt umfassende Einblicke in die Quellen, Prozesse und Ergebnisse moralischer Kämpfe in und um Märkte, indem Prozesse der Entstehung, Reproduktion und Veränderung der zugrunde liegenden moralischen Ordnungen aufgezeigt werden. Auch Status- und Machtunterschiede, Allianzen und politische Strategien sowie die allgemeinen kulturellen, sozialen und politischen Kontexte, in denen sich die Kämpfe entfalten, werden betrachtet. Insgesamt spiegeln die Beiträge in diesem Band die moralische Wende wider, die derzeit in der Organisations- und Wirtschaftssoziologie zu beobachten ist, und knüpfen an die jüngsten Entwicklungen in der Moralsoziologie an.
Schiller-Merkens, S. and P. Balsiger (Eds) (2019). The Contested Moralities of Markets, Research in the Sociology of Organizations (Vol. 63), Emerald Publishing Limited.
Balsiger, P. and S. Schiller-Merkens (2019). Moral Struggles in and around Markets, in S. Schiller-Merkens, P. Balsiger (Eds), The Contested Moralities of Markets, Research in the Sociology of Organizations, (Vol. 63), Emerald Publishing Limited, pp. 3-26.
Bei dem diesjährigen 76. Annual Meeting der Academy of Management in Boston war das RMI-Team hervorragend vertreten.
Maximilian Heimstädt erhielt den Best Reviewer Award der Strategizing Activities And Practices Interest Group und stellte in einer Session ein Paper über Algorithmen-Expertise vor. Des Weiteren leitete er ein Panel zum Thema “Digital Strategizing.“
Hendrik Wilhelm war mit zwei Aufsätzen zu den Themen „Koordination in Organisationalen Routinen“ sowie „Relationale Affekte in Co-Leadershipteams“ in zwei Sessions präsent. Der erstgenannte Beitrag wurde dabei Finalist für den OMT Best International Paper Award und außerdem in die Best Paper Proceedings der Konferenz aufgenommen.
Das Konferenzreisen-Programm des DAAD förderte beide Aufenthalte.
Weiterhin ist ein Beitrag von RMI Direktor Guido Möllering zu kontextuellen Einflüssen auf die Entwicklung von Gründerteams von seinen Co-Autoren präsentiert worden.
Bei der Academy of Management handelt es sich um die weltweit größte Vereinigung von Forscherinnen und Forschern im Bereich Management. Das diesjährige Annual Meeting hatte etwa 11.000 Teilnehmer.
An der RMI Professur für Strategische Organisation ist eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) zu besetzen. Es erwarten Sie vielfältige und herausfordernde Aufgaben in Forschung und Lehre, denen Sie als Teil eines engagierten und international vernetzten Teams begegnen werden. Die Möglichkeit zur Promotion (Dr. rer. pol.) wird gegeben und aktiv unterstützt.
Details finden Sie hier / English Version
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Hendrik Wilhelm, der seit dem 01.06.2019 die RMI Professur für Strategische Organisation innehat, erhält die Ernennungsurkunde zum Universitätsprofessor. Mit ihm freuen sich RMI Institutsdirektor Guido Möllering und der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Marcel Tyrell.
Herr Wilhelm wird im kommenden Wintersemester die folgenden Seminare geben: Strategy, Theories of Organization sowie Strategisches und Internationales Management. Das RMI Team freut sich auch auf weiteren Zuwachs: Herr Wilhelm wird im Rahmen einer neuen Wissenschaftlichen Mitarbeiter-Stelle eine Dissertations-Vorhaben betreuen (Stellenausschreibung folgt).
Dr. Kirti Mishra vom Indian Institute of Management Udaipur (IIMU, Indien) gab im Rahmen eines RMI Research Seminars Einblicke in ihre Feldforschung, bei der sie hinter die Kulissen von Unternehmen geschaut hat, die strategisch auf den Klimawandel reagieren (müssen). Sie analysiert im Energiesektor verschiedene Gruppen und deren Praktiken gegenüber den Umweltherausforderungen. In der engagierten Diskussion ihrer Ergebnisse mit Forschenden und Studierenden der UW/H zeigte sie ein Repertoire von Aktivitäten in Unternehmen auf, mit denen die Problematik noch erfasst, zugleich aber auch schon bearbeitet werden.
Dr. Mishra ist am IIMU Assistenzprofessorin im Bereich Organizational Behavior und Human Resources und promovierte an der Monash University in Australien. Durch ihren strukturationstheoretisch geprägten „Strategy-as-Practice“-Ansatz steht sie mit ihren Arbeiten der Forschung am RMI nahe.
Der Aufsatz "How Core Actors Coordinate Distal Actors in Organizational Routines" von Thomas Lübcke (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger), Norbert Steigenberger (Jönköping University), Hendrik Wilhelm (RMI, Universität Witten/Herdecke) und Indre Maurer (Universität Göttingen) wurde für den Best International Paper Award 2019 der Organization and Management Theory Division der diesjährigen AoM (Academy of Management)-Konferenz in Boston, MA, USA, nominiert. Mit dieser Nominierung wurden nur vier Beiträge aus mehreren hundert eingereichten Arbeiten ausgezeichnet. Das Paper wurde auch in die Best Paper Proceedings der Konferenz aufgenommen, die im August 2019 veröffentlicht werden.
Prof. Dr. Hwee Hoon Tan von der Singapore Management University stellte am 6. Juni 2019 im RMI Research Seminar ihre Forschungsergebnisse zu Vertrauen in verschiedenen Kulturen vor. Sie arbeitet dazu an einem großen Projekt mit den renommierten Vertrauensforschern David Schoorman and Roger Mayer und untersucht, inwieweit deren Modell in verschiedenen Kulturen anwendbar ist. Die Studie beruht auf Daten aus 29 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nord- und Südamerika.
Hwee Hoon Tan ist Professorin für Organisational Behaviour & Human Resources an der Lee Kong Chian School of Business der angesehenen Singapore Management University. In ihrer Forschung untersucht sie interpersonelles Vertrauen in Organisationen und verschiedenen Kulturen. Sie hat in angesehenen Zeitschriften wie Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, Journal of Applied Psychology und Human Relations publiziert.
Dr. habil. Hendrik Wilhelm hat zum 1. Juni 2019 einen Ruf auf die RMI Professur für Strategische Organisation angenommen. „Damit ist das RMI-Professorenteam jetzt vollständig und noch breiter aufgestellt“, freut sich RMI-Direktor Guido Möllering.
Vor seinem Wechsel nach Witten war Hendrik Wilhelm als Akademischer Rat am Seminar für ABWL, Unternehmensentwicklung und Organisation der Universität zu Köln tätig. Er lehnte einen Ruf auf die W2 Professur für Organisationalen Wandel und Innovation an die Europa-Universität Flensburg ab. In seiner Forschung untersucht Hendrik Wilhelm organisationale Anpassungsprozesse als Zusammenspiel von Individuen, Teams und Organisationen. Grundlage seiner empirischen Arbeiten sind quantitative als auch qualitative Forschungsansätze.
In aktuellen Projekten erforscht er bspw. die strategischen Anpassungsfähigkeiten mittelständischer Unternehmen, Routinen in der Seenotrettung, Reaktionen auf negatives Leistungsfeedback in Crowdfunding-Kampagnen und die Auswirkungen zwischenmenschlicher Affekte in Chirurgenteams. Er wird Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Fakultät anbieten. „Ich freue mich, Teil der Universität Witten/Herdecke sein zu dürfen“, sagt Hendrik Wilhelm, „insbesondere, die Universität als Teil des RMI-Teams in Forschung, Lehre und Praxisdialog in Zukunft mitzugestalten.“
RMI-Direktor Guido Möllering hat zusammen mit Eugenia Rosca, Arpan Rijal und Julia Bendul den Artikel "Supply chain inclusion in base of the pyramid markets: A cluster analysis and implications for global supply chains” in der Zeitschrift International Journal of Physical Distribution & Logistics Management veröffentlicht. In ihrer empirischen Studie zeigen sie, wie in den ärmsten Regionen der Welt lokale Akteure über Klein(st)unternehmen und in Kooperation mit NGOs in globale Wertketten eingebunden werden.
Das internationale Forscherteam liefert damit wichtige Erkenntnisse über die strategischen und organisatorischen Kooperationsmöglichkeiten, um die wirtschaftliche Entwicklung zur Bekämpfung von Armut und zugleich neue Formen der globalen Wertschöpfung zu befördern. Multinationale Unternehmen arbeiten meist mit Unternehmen vor Ort zusammen, die wiederum – mehr oder weniger direkt und teils unterstützt von NGOs – Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze an der Wertschöpfung beteiligen.
Die Autoren der „Supply Chain Inclusion“-Studie zeigen, dass dabei unterschiedliche Wege beschritten werden, um die lokalen sozio-ökonomischen und kulturellen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Link zum Artikel: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2018-0042
Zwei junge Unternehmen, ein Handwerksbetrieb und ein erfolgreicher Mittelständler sind Preisträger des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel 2019“. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin wurden die Unternehmen im Kreise aller Nominierten für ihr Engagement geehrt. Die Gewinner sind:
Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“: Kuchentratsch UG, München
Kategorie „Große Unternehmen“: Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG – Robokids, Rehau
Kategorie „Jung und Innovativ”: Too good to Go – Die App zur Lebensmittelrettung – GmbH, Berlin
Kategorie „Handwerk”: INFORM GmbH – Handwerk hilft e.V., Saarburg
Den bundesweiten Wettbewerb richtet die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke (UW/H), dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und DIE JUNGEN UNTERNEHMER aus. Prämiert werden Unternehmen für innovative und kreative Formen gelebter Verantwortung. Ziel ist es, Vorbilder zu zeigen, Engagement sichtbar zu machen und zur Nachahmung zu inspirieren.
RMI-Direktor Guido Möllering ist Mitglied im Jury-Team: „Als Wissenschaftler unterstütze ich gerne, dass Verantwortung vom abstrakten Ideal zum konkreten Handeln wird. Die diesjährigen Nominierten und Preisträger sind als gute Beispiele dafür äußerst hilfreich und wirksam.“
Pressemeldung: https://www.uni-wh.de/detailseiten/news/vier-unternehmen-fuer-wegweisendes-engagement-ausgezeichnet-7671/
Weitere Informationen: www.mein-gutes-beispiel.de
Kooperation ist heute der wichtigste strategische Ansatz in der Wirtschaft, argumentiert John Child, Autor des ersten, 1998 erschienenen, und immer noch führenden Lehrbuchs über Kooperationsstrategie, das Oxford University Press demnächst in seiner dritten Auflage veröffentlicht. Im Rahmen der Reihe "RMI Distinguished Lecture" diskutierte er die neuesten Entwicklungen in Forschung und Praxis in Bezug auf Allianzen, Joint Ventures, Netzwerke und Partnerschaften mit etwa 50 Gästen am 9. April abends im Audimax der Uni Witten/Herdecke.
RMI-Gastprofessor Alfred Kieser stellte den Referenten vor. Vor der Diskussion mit dem Publikum kommentierte Prof. Dominika Latusek von der Kozminski Universität das Thema aus der Perspektive einer jüngeren Professorin im Bereich der inter-organisationalen Beziehungen.
John Child ist Professor of Commerce an der University of Birmingham. Seit seiner wegweisenden Arbeit zu Strategic Choice in den 1970er Jahren zählt er zu den einflussreichsten Denkern für Management und Organisationen. Seine jüngsten Arbeiten konzentrierten sich auf die kooperative Strategie, die Internationalisierung von KMUs und die Rolle der Hierarchie in Wirtschaft und Gesellschaft.
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat RMI-Postdoc Dr. Maximilian Heimstädt eine Einschätzung zum “Wikipedia Blackout” anlässlich der geplanten EU-Urheberrechtsreform gegeben. Im Interview spricht er über die Community hinter der Wikipedia, erfolgreiche Framing-Strategien und die Verzahnung aus Online- und Offline-Protestformen. In einem ergänzenden Interview mit Vertretern der Universität Witten/Herdecke berichtet er ausführlicher über die in Artikel 13 der EU-Richtlinie geforderten “Uploadfilter” zur Identifizierung urheberrechtlich geschützter Inhalte auf Plattformen wie Youtube oder Facebook. Seine Einschätzung zu den Gefahren dieser Algorithmen speist sich unmittelbar aus seinem laufenden Forschungsprojekt zu "Algorithmen-Governance". Im Rahmen dieses Projektes war Maximilian Heimstädt im Herbst 2018 als Gastforscher an der Columbia University in NYC.
Klimawandel, Migration, Digitalisierung: Viele Herausforderungen der Gegenwartsgesellschaft erfordern (neue) Formen der Zusammenarbeit von Organisationen. Bedingungen für das Gelingen solcher Zusammenarbeit rücken daher zunehmend in den Fokus moderner Organisations- und Managementforschung. Am 2. März hielt Dr. Maximilian Heimstädt auf der Tagung „Digitalcourage“ in der Evangelischen Akademie Tutzing einen Vortrag zu Organisationen und Arbeitsformen der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland. Mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutierte er, wie Prozesse der digitalen Transformation (von Datenschutz bis Open Knowledge) in Zusammenarbeit von staatlichen, marktlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gestaltet werden können.
Beim diesjährige „RMI Tag der Unternehmensführung“ haben sich rund 150 TeilnehmerInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft im Audimax der Uni Witten/Herdecke mit dem Thema Verantwortungsbereitschaft auseinandergesetzt. Wer hat die Kompetenz, aber auch die Motivation, Verantwortung zu übernehmen? Wem wird die Verantwortungsübernahme fachlich, aber auch moralisch zugetraut? Wie weit reicht die Verantwortung für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft? Wenn die Welt sich verändert, kommt auch Bewegung in das Verantwortungsgefüge. Das benötigte Wissen ist ein anderes. Erfahrung ist nicht per se hilfreich. Noch mehr Ungewissheit muss ausgehalten werden - und es braucht keine „Helden“ (oder „Sündenböcke“) mehr, sondern proaktive Vermittler für gemeinsam getragene Verantwortung. Dies wiederum erfordert eine gewisse Haltung und Vertrauen.
Zum Programm trugen bei:
Dr. Iris Kaib, Deutsche Post DHL, „Verantwortung als Unternehmenskultur“
Aysel Osmanoglu, GLS Bank, „Zukunft der Verantwortung: GLS Bank“
Prof. Dr. Christian Neuhäuser, TU Dortmund, „Bedeutung(en) von Verantwortung“
Prof. Dr. Ann-Marie Nienaber, Coventry University, “Verantwortung braucht Vertrauen”
Dr. Brigitte Mohn, Bertelsmann Stiftung, Grußwort
Prof. Dr. Martin Butzlaff, Universität Witten/Herdecke, Grußwort
Aart De Geus, Bertelsmann Stiftung, Schlusswort
Prof. Dr. Guido Möllering, Universität Witten/Herdecke, Veranstaltungsleitung
Hier geht's zum Veranstaltungsbericht mit Foto-Strecke als kleinen Rückblick auf den Tag. Es folgen bald noch Links zu einzelnen Vortrags-Mitschnitten.
Berichterstattung in der Westfalenpost vom 05.03.2019
Der „RMI Tag der Unternehmensführung 2019“ setzte die Tradition früherer RMI-Symposien fort und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu wichtigen Themen, die Führungskräfte, Forschende und Gesellschaft bewegen.
Die Politikwissenschaftlerin Dr. Eszter Simon von der Universität Birmingham hat derzeit ein dreimonatiges Stipendium als Gastwissenschaftlerin am RMI für ein Publikationsprojekt über die Institutionalisierung von Vertrauen. Vom 18. - 22.02.2019 arbeitete sie bereits intensiv vor Ort in Witten mit RMI-Direktor Guido Möllering zusammen. Beide sind sich einig: „Wir haben den theoretischen Bezugsrahmen inzwischen stark verbessert und damit auch die Möglichkeiten, wichtige Erkenntnisse aus dem empirischen Fall zu gewinnen.“ Konkret handelt es sich bei diesem Fall um den „Heißen Draht“ zwischen Moskau und Washington, einem Instrument der Krisenkommunikation aus dem Kalten Krieg, das auch heute noch existiert. Das Projekt trägt zur Internationalität und Interdisziplinarität der Forschung am RMI bei.
In Münster traf sich in diesem Jahr vom 13. - 15. Februar die wissenschaftliche Kommission Organisation (WK ORG) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) zu ihrem jährlichen Workshop. Witten/Herdecke gehörte insbesondere dank der RMI-Beiträge erneut zu den am stärksten vertretenen Universitäten mit Themen wie „Predatory Publishing“, „Theoriefiktionen“ und „Interstitial Networks“. Für viele der knapp 100 Teilnehmenden war das Highlight der Tagung die Sitzung mit RMI-Forschungsprofessor Ortmann und RMI-Gastprofessor Kieser im anregenden Schlagabtausch über Führungsideologien. Maximilian Heimstädt und Leona Henry nahmen auch an dem vorgelagerten Nachwuchsworkshop teil.
Personalbeschaffung, Controlling, Planung, Produktentwicklung: Schon heute können Teile der Routinearbeit, die in Unternehmen geleistet wird, durch datenzentrierte Automatisierungstechnologien – „Algorithmen“ – ergänzt oder ersetzt werden. Am 1. Februar berichtete RMI-Postdoc Maximilian Heimstädt in einem Praxisvortrag bei der Organisationsberatung gfa | public in Berlin von den Ergebnissen seines aktuellen Forschungsprojektes zu Algorithmen-Governance in der öffentlichen Verwaltung. Als Teil dieses Projektes war er im Herbst 2018 als Gastwissenschaftler an der Columbia University in New York. Gemeinsam mit Beratern und Gästen aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft diskutierte Heimstädt Fragen wie „Ab wann gilt eine Entscheidung in Organisationen als automatisiert?“, „Wie lässt sich der für Organisationen wichtige Ermessensspielraum in Algorithmen umsetzen?“, und „Wie verhalten sich Black-Box-Technologien zu bestehenden Widerspruchsrechten der Bürger an die Verwaltung?“.
Rainer Strack (Honorarprofessor am RMI und Senior Partner und Managing Director der Boston Consulting Group) unterstützte das Weltwirtschaftsforum in Davos mit Handlungsempfehlungen zum "Reskilling", also Umschulungen für Arbeitnehmer zu finden, deren Arbeitsplätze vom (digitalen) Wandel bedroht sind. Er war dabei Podiumsdiskussions-Teilnehmer und gab auch ein Interview, was Sie hier sehen können.
Die aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums und der Boston Consulting Group beschäftigt sich mit der zentralen Frage: Lohnt sich dieser Umschulungsaufwand? "Wir zeigen auf, welche Chancen eine Umschulungsoffensive für Firmen und Regierungen bringt“, erklärt Hon.-Prof. Dr. Rainer Strack. Darüber hinaus spricht die Studie elf Handlungsempfehlungen von der Notwendigkeit einer strategischen Personalplanung bis hin zu einer Kultur des Lebenslangen Lernens aus, die in Expertenkommissionen von über 60 Mitgliedern erarbeitet wurden und in branchenspezifischen Roadmaps weiter konkretisiert werden. „Die Zeit zu Handeln ist jetzt und der Fahrplan liegt bereit“, sagt Rainer Strack.
Leona Henry und Guido Möllering waren mit vielfältigen Beiträgen beim Workshop on „Trust Within and Between Organizations“ des First International Network on Trust (FINT) an der Universität St. Gallen vertreten. Gemeinsam stellten sie ihre Studie „Collective Corporate Social Responsibility: The Role of Trust as an Organizing Principle“ vor und hielten, als Managing Editor und Editor-in-Chief, ein Editorial Board Meeting des Journal of Trust Research ab. An der Konferenz nahmen mehr als 100 Wissenschaftler(innen) aus der ganzen Welt teil.
Der SRF 2 Kultur griff ein Interview mit RMI-Direktor Guido Möllering zum Thema Umgang mit Veränderungen auf und stellte seine Thesen vor wie: „Wir verwechseln Stabilität mit Sicherheit“. Dieser Radiobeitrag steht in Zusammenhang mit der RMI-Debatte mit Rita Süssmuth u.a. am 18. Dezember 2018 zum Thema Veränderungsfähigkeit, verweist aber auch schon auf das Thema Verantwortungsbereitschaft, das beim RMI Tag der Unternehmensführung am 1. März 2019 im Fokus steht. Die Botschaft des RMI ist bei aller berechtigter Beunruhigung, dass man Veränderungen und Verantwortung gemeinsam meistern kann.
Hier geht es zum SFR-Beitrag
Wie veränderungsfähig sind Menschen, Organisationen und die Gesellschaft? Hierzu diskutierten am 18. Dezember 2018 die frühere Bundestagspräsidentin Professorin Rita Süssmuth und die Professoren Thomas Druyen und Guido Möllering bei einer öffentlichen „RMI Debatte“ im Audimax der UW/H.
Allenthalben ist von Veränderung, Wandel, Transformation oder „Change“ die Rede. Immer unbeständiger, unvorhersehbarer, komplexer und unklarer scheint die heutige Welt, doch Veränderungen sind selten populär. Statt Chancen zu ergreifen, greift oft erst einmal das Beharrungsvermögen auf individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene. Das RMI hatte zu einer Debatte darüber eingeladen, wie veränderungsfähig und -bereit wir in Deutschland sind. Wie gehen wir in die Zukunft? Was lernen wir aus der Vergangenheit? Was bewahren wir? Woran passen wir uns an? Was gestalten wir?
Das Video dokumentiert die gesamte Debatte und insbesondere Ritas Süssmuths bewegendes Abschlussstatement ab Zeitmarke 1:37:00 ist sehens- und bedenkenswert! Hierzu hat RMI Direktor Guido Möllering am Morgen der Veranstaltung auch noch ein Radio-Interview im Deutschlandfunk Kultur gegeben.
Parasiten des Zweifels - „Merchants of Doubt“ und die Sehnsucht nach Gewissheit
lautete der Titel der Vorlesung von RMI-Forschungsprofessor Günther Ortmann, den er am 16. Dezember 2018 im Hörsaal des Deutschlandfunks Nova gehalten hat. Das Lob des Zweifels wird heute allenthalben gesungen, aber: "Zweifel kann lähmen, und das ist nicht nur eine Sache rationalen Denkens", so der Organisationsforscher Ortmann. Der 2010 erschienene US-Bestseller "Merchants of Doubt" (N. Oreskes, E. M. Conway) beschreibt, wie selbst ernannte Experten Zweifel säen, Zweifel, die lähmen sollen: Organisation von Zweifel. Eine andere Klasse von Parasiten des Zweifels bedient dagegen unser aller Sehnsucht nach Gewissheiten, mit Sicherheitsangeboten oder -fiktionen. Die Beratungsindustrie handelt damit, und die künstliche Intelligenz mit ihren Algorithmen auf ihre Weise auch. Sie nähren sich an der Furcht vor dem Zweifel.
Am Mittwoch, 16. Januar 2019 hält Prof. Ortmann diesen interessanten Vortrag noch einmal im Rahmen der Vortragsreihe "Mensch, Umwelt, Technik" der Daimler-Benz-Stiftung im Mercedes-Benz Kundencenter Bremen (Im Holter Feld, 28309 Bremen, 19:00 Uhr). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist allerdings beim Veranstalter erforderlich und kann auf Grund des begrenzten Platzangebots nur in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt werden.
Leona Henry, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Reinhard-Mohn-Institut, hat zusammen mit Tine Buyl und Rob Jansen (Tilburg University) in der Zeitschrift „Journal Business Strategy and the Environment“ den Artikel „Leading corporate sustainability: The role of top management team composition for triple bottom line performance” veröffentlicht. Der Beitrag befasst sich mit der Frage, in wie fern die Zusammenstellung von Management Teams - im Besonderen die Vielfalt von Expertise und die Präsenz eines „Chief Sustainability Officers“ - Organisationen dabei hilft, nachhaltiger zu werden.
Dabei zeigte sich, dass bei Unternehmen, deren Management Teams vielfältig aufgestellt sind - also über mehrere Experten verschiedener Fachrichtungen verfügen - eine höhere Nachhaltigkeitsperformance erreicht wird. Die Präsenz von einem Chief Sustainability Officer zeigt allerdings keinen signifikanten Einfluss. Der Artikel bietet Einsicht darin, wie Unternehmensführung und organisationale Nachhaltigkeit zusammenhängen.
Ist Vertrauen zwischen Feinden möglich? Prof. Nicholas J. Wheeler, britischer Experte für Internationale Beziehungen und Direktor des Konfliktforschungsinstituts ICCS an der Universität Birmingham, stellte sein Buch „Trusting Enemies“ vor, in dem er behauptet, dass persönliche Beziehungen zwischen den Staatschefs entscheidend sind. Er diskutierte seine durchaus brisante These in Zeiten von Trump, Putin, Kim u.a. mit gut 50 Gästen im Audimax der UW/H.
Dem RMI ist es gelungen, mit dieser Veranstaltung den internationalen und interdisziplinären Austausch zum Thema Vertrauen zu fördern. Die Anwesenden kamen aus diversen Fachrichtungen, Altersgruppen und Nationen. Prof. Wheeler gelang es, nicht nur zahlreiche historische Belege für seine These anzuführen, sondern auch den Bogen zu ganz aktuellen Ereignissen und Anwendungsfeldern außerhalb der Politik zu schlagen.
Sind die deutschen Unternehmen und ihre Mitarbeiter ausreichend auf die voranschreitenden digitalen Transformationsprozesse vorbereitet? Dieser Frage widmete sich das 12. bdvb-Forum bei einer Podiumsdiskussion, zu der die bdvb Bezirksgruppe Westfalen in Kooperation mit dem Reinhard-Mohn-Institut und der bdvb-Hochschulgruppe Witten am 15. November ins FEZ eingeladen hatte.
Dr. Richard Ammer (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Iserlohn), Sven Baumgarte (DEW21 GmbH, Dortmund), Max Elster und Maximilian Locher (beide Universität Witten/Herdecke) diskutierten mit rund 40 Gästen die Frage „Digitale Transformation – Schönheits- oder Herzoperation?“ und erörterten den Fortschritt und die Auswirkungen der Digitalen Transformation auf unsere Gesellschaft sowie Wirtschaft.
Traditionell klang der Abend mit einem gemeinsamen Grünkohlessen aus.
Der Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ ist ein bundesweiter Preis für gesellschaftliches Engagement und Verantwortungsübernahme von Unternehmen. Er wird seit 2011 jährlich federführend von der Bertelsmann Stiftung durchgeführt. Am 15. Oktober 2018 beginnt die neue Runde, von nun an auch in Kooperation mit dem RMI. Prof. Dr. Guido Möllering begleitet den Wettbewerb wissenschaftlich und ist neues Mitglied der unter anderem mit Liz Mohn, Hans-Peter Wollseifer und Sarna Röser hochkarätig besetzten Jury. Der RMI-Direktor freut sich auf die Möglichkeit, unternehmerische Verantwortung ganz im Sinne der Arbeit des RMI zu fördern. „Nicht Skandale, sondern positive Vorbilder wirken motivierend auf Führungskräfte“, sagt Möllering, „und inspirieren zu eigenen Initiativen.“ Es gibt vier Preiskategorien für kleine und große Unternehmen, Handwerksbetriebe und – als neue Kategorie in 2018/19 – „Jung & innovativ“ (Start-up, Gründung, Nachfolge). Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2019 über www.mein-gutes-beispiel.de eingereicht werden.
Dr. Maximilian Heimstädt, Postdoktorand am RMI, arbeitet derzeit dank eines Fulbright Reisestipendiums an der Columbia University in New York. Als Gast der Forschergruppe rund um den renommierten Wirtschaftssoziologen und Organisationsforscher Prof. David Stark forscht er zur Governance automatisierter Entscheidungssysteme ("Algorithmen"). Prof. Stark und sein Center on Organizational Innovation zeichnen sich durch ethnografische und netzwerkanalytische Studien über innovative Organisationsformen aus.
„Immer öfter werden Entscheidungen in Organisationen von Algorithmen getroffen“, erläutert Heimstädt seine ersten Ergebnisse. „Die Automatisierung soll Entscheidungen nicht nur schneller, sondern vor allem auch fairer machen. Nicht selten stellt sich jedoch heraus, dass Algorithmen bestehende Probleme, zum Beispiel Diskriminierung, eher verstärken als lösen.“
Neben dem Fulbright Reisestipendium erhält Dr. Heimstädt ein Forschungsstipendium der Heinrich-Hertz-Stiftung als Unterstützung für die Unterhaltskosten in New York.
Aktuell ist eine Stelle am RMI ausgeschrieben:
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter
zum Thema „Vernetztes Vertrauen“
Wenn Sie Interesse daran haben, sich als neues Mitglied des RMI-Teams in Forschung, Lehre und Praxisdialog aktiv einzubringen, finden Sie hier die aktuelle Stellenbeschreibung.
Thematisch ist eine Ausrichtung auf den Themenbereich „Vernetztes Vertrauen in und zwischen Organisationen“ gewünscht, d.h. eine mehr als dyadische Betrachtung von Vertrauenspraktiken. Es handelt sich um eine auf drei Jahre befriste Stelle mit mindestens 50% und bis zu 100% einer Vollzeitstelle (abhängig von Qualifikation und Projektzuschnitt).
Die Stelle soll zum 1. Januar 2019 besetzt werden.
Nicht nur Konzerne und Startups, sondern auch Verwaltungsorganisationen müssen innovativ sein, um die Anforderungen ihrer Umwelt bestmöglich zu bedienen. Um die Vielfalt und ständige Veränderung dieser Bedürfnisse einzufangen, setzen vereinzelte Verwaltungsorganisationen bereits auf kollaborative Open-Innovation-Praktiken, wie sie ursprünglich im Privatsektor entwickelt wurden. In den meisten Verwaltungen herrscht jedoch noch große Zurückhaltung gegenüber dieser neuen und vielversprechenden Form der Innovation.
In ihrem neuen Artikel untersuchen Dr. Maximilian Heimstädt (RMI-Postdoc) und Dr. Georg Reischauer (WU Wien) die Rolle von Sprache und Diskursveränderung als Vorbedingung des Einsatzes dieser offeneren Innovationspraktiken.
Der Beitrag mit dem Titel „Framing innovation practices in interstitial issue fields: open innovation in the NYC administration“ erscheint in einem Sonderheft der neu gegründeten Zeitschrift Innovation: Organization & Management.
Elieti Fernandes (Unisinos Business School, Porto Alegre, Brasilien) war im Rahmen eines CAPES/DAAD-Stipendiums von Anfang Februar bis Ende August 2018 Gastdoktorandin am RMI, wo sie ihre Forschung zur Rolle von Vertrauen in internationalen Unternehmenskooperationen fortsetzte.
„Mein Gastaufenthalt in Witten bot mir eine hervorragende Gelegenheit, Erfahrungen mit dem RMI-Team auszutauschen und von Prof. Möllering und anderen mehr über Organisationsforschung und interorganisationale Beziehungen zu lernen“, blickt Frau Fernandes zurück. „Ich habe Forscher wie Sascha Albers, Jane Lê und Patrik Aspers getroffen und in Deutschland meine theoretischen Grundlagen und Publikationsstrategien für internationale Zeitschriften erweitert, sodass ich nun dazu beitragen kann, dass einflussreiche Publikationen auch aus meinem Land kommen.“
Die internationale Ausrichtung des RMI kommt durch Gastaufenthalte dieser Art zum Ausdruck und wird lebendig. Die Zusammenarbeit mit Frau Fernandes hat das Team bereichert und wird in Zukunft fortgesetzt. Wir haben von unserem Gast auch viel über das Leben in Brasilien erfahren. Das RMI-Team wünscht Elieti Fernandes alles Gute für ihre Promotion und die weitere Karriere.
Wie Organisationen mit Zukunft umgehen ist ein zentrales Forschungsinteresse am Reinhard-Mohn-Institut und war Thema beim diesjährigen Tag der Unternehmensführung. Dazu passend sind nun zwei Buchkapitel im Sammelband How Organizations Manage the Future: Theoretical Perspectives and Empirical Insights herausgegeben von Dr. Matthias Wenzel und Prof. Dr. Hannes Krämer erschienen.
Dr. Maximilian Heimstädt (Postdoc am RMI) arbeitet in seinem Beitrag (mit Dr. Georg Reischauer, WU Wien) heraus, wie Organisationen durch Offenheitspraktiken (z.B. Open Innovation, Open Strategy) mit der Ungewissheit des Zukünftigen umgehen können.
Professor Dr. Günther Ortmann (Forschungsprofessor am RMI) wirft in seinem Beitrag (mit Prof. Dr. Jörg Sydow, FU Berlin) einen kontinentalphilosophischen Blick auf die Organisation der Zukunft und vor allem auf die Rolle von Kreativität in diesem Prozess.
Einmal im Jahr findet in den USA das „Annual Meeting of the Academy of Management“, die weltweit größte und wichtigste Konferenz für Management und Organisationsforschung, statt. Dieses Jahr treffen sich vom 10.-14. August rund 10.000 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt in Chicago. Das RMI wird dabei von Dr. Maximilian Heimstädt vertreten. Für seinen Beitrag „Paradoxes of Openness as a Strategy“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Leonhard Dobusch) wurde er dabei zudem für den renommierten „Carolyn Dexter Award for Best International Paper“ nominiert. Für die Teilnahme an der Konferenz konnte Dr. Heimstädt ein Reisestipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes einwerben. Die Teilnahme an der wichtigen US-Konferenz erlaubt es Dr. Heimstädt nicht nur neue Impulse für die eigene Arbeit zu sammeln, sondern auch die RMI-spezifische Perspektive auf Organisation, Strategie und Unternehmensführung einem breiteren internationalen Publikum zu präsentieren.
Prof. Dr. Guido Möllering erörterte in seinem Gastvortrag am Heidelberg Center for American Studies (HCA), welche Verantwortung mit geschenktem Vertrauen einhergeht.
Im Rahmen der hochkarätigen Ringvorlesung zum Thema „Trust and Authority in the United States“ (u.a. mit Jeffrey Alexander und Hans Joas) folgte der RMI-Direktor der Einladung des DFG Graduiertenkollegs am HCA der Universität Heidelberg. Ausgangspunkt seines Vortrags über „Trust Obliges? On Rational, Routinized and Reflexive Responsibility“ war die These des Soziologen Georg Simmel, dass „ein Vertrauen, das uns gewährt ist, ein fast zwingendes Präjudiz enthält.“ Mag diese These auch sehr idealistisch sein, so Möllering, regt sie doch zum Nachdenken über den moralischen Gehalt von Vertrauen und die Grundlagen verantwortungsvoller Vertrauensbeziehungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an.
Das Zusammenspiel aus Theorie und Praxis steht im Mittelpunkt der Lehre am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung.
Im Sommersemester 2018 hatten nun 15 Studierende des dreimonatigen Projektseminars „Strategie und Change Management“ (durchgeführt von Prof. Guido Möllering und Clemens Wagner) die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der Stadtwerken Witten theoretisch fundiert zu analysieren und praxisnah zu diskutieren. Die Abschlusspräsentation der vier studentischen Projektgruppen vor Vertretern der Geschäftsführung der Stadtwerke fand am 9. Juli 2018 statt. Hierbei wurde deutlich, dass auch nach mehr als 20 Jahren die Folgen der Liberalisierung bei den Stadtwerken noch immer ein Thema sind, während zugleich weitere große Veränderungen, wie die digitale Transformation, demografischer Wandel und Nachhaltigkeit wichtige Chancen und Risiken bergen. Die Studierenden stellten viele Ideen vor, wie die Stadtwerke die Potenziale nutzen könnten und welche Herausforderungen zu erwarten sind, wenn organisatorische und nicht zuletzt auch kulturelle Veränderungen anstehen.
Weitere Informationen zum Projektseminar mit den Stadtwerken Witten gibt es in der aktuellen Pressemeldung.
Vom 5. Bis 7. Juli 2018 trafen sich Organisationsforscherinnen und -forscher auf der jährlichen Konferenz der European Group for Organizational Studies (EGOS). Die diesjährige Tagung fand in Tallinn statt. Das Reinhard-Mohn-Institut war mit verschiedenen Beiträgen an der Konferenz beteiligt: Leona Henry (Doktorandin) und Elieti Fernandes (Gastdoktorandin) nahmen am Konferenztrack „Collaborating across Organizational Boundaries“ teil. Leona Henry präsentierte dabei ein aktuelles Forschungspapier (mit Guido Möllering) zum Nutzen von Überraschungen in der Koordination von Suchkonsortien. Maximilian Heimstädt (Postdoktorand) präsentierte ein Arbeitspapier mit dem Titel „Experimenting through Paradox“, in dem er untersucht, wie Organisationen transparenter werden können, ohne sich dabei völlig von notwendiger Undurchsichtigkeit zu trennen. Simone Schiller-Merkens (Postdoktorandin) trat dieses Jahr gemeinsam mit Philip Balsiger (Université de Neuchâtel) und Sébastien Mena (City University London) als Gastgeberin eines eigenen Konferenztracks mit dem Titel „Morality and Moral Struggles in and beyond Organizations“ auf.
Von der ersten Annahme über die Datenerhebung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse offen zugänglich, nachvollziehbar und weiterhin nutzbar: das sind Forschungsprozesse in offener Wissenschaft. Am 8. Juni hat RMI-Postdoc Dr. Maximilian Heimstädt im Rahmen einer Podiumsdiskussion in den Räumen der Wikimedia Deutschland die Frage diskutiert, ob Offenheit das zeitgemäße Organisationsprinzip der Wissenschaft ist. Die Diskussion stellte gleichzeitig den Abschluss des Open Science Fellowships dar, durch welches Maximilian Heimstädt für die Arbeit an einem Hochschullehrbuch mit dem Titel „Organizing Openness“ gefördert wurde. Mehr zum Aktuellen Stand des Projektes findet sich auf dem Buch-Blog: o2c2.org
Maximilian Heimstädt, Postdoc am RMI, hat gemeinsam mit Leonhard Dobusch (Universität Innsbruck) den Artikel “Von Fake Journals zu Fake News: Ausweg Open Peer Review?” im Synergie – Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre veröffentlicht. In ihrem Beitrag beleuchten die Autoren eines der Risiken der Digitalisierung im Wissenschaftsbetrieb: Predatory Open Access Journals und deren potenzielle Instrumentalisierung für Fake News. Als Ansatz um dieses Risiko zu mindern und die Vorteile der Digitalisierung zu stärken, schlagen die Autoren neue und vor allem offenere Praktiken der wissenschaftlichen Begutachtug (Open Peer Review) vor. Der offen lizenzierte Artikel findet sich hier.
Mit seiner These von Organisationen als mächtig(st)e Akteure der Moderne bewegt sich RMI-Forschungsprofessor Günther Ortmann seit jeher in interdisziplinärem Terrain. Am 18. Mai war er daher eingeladen, die juristische Tagung “Unternehmensverantwortung für Unternehmenskriminalität” am House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main durch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung zur Notwendigkeit strafrechtlicher Unternehmensverantwortung zu komplementieren.
Die Inhaberin/der Inhaber dieser Professur vertritt das Fach Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Strategisches Management und Organisation, mit Betonung auf den Wechselwirkungen dieser Bereiche. „Mit dieser besonders profilierten Professur kann das RMI noch deutlichere Impulse für die Unternehmensführung geben“, erwartet RMI-Direktor Guido Möllering, „in der Forschung, im Praxisdialog und ganz besonders auch in der Lehre im neuen Master-Studiengang Strategy & Organization (M.Sc.)“.
Die Bewerbungsfrist ist der 4. Juni 2018 und die Stellenausschreibung finden Sie im Jobportal der UW/H.
Im Rahmen der Distinguished-Lecture-Vortragsreihe am RMI bot am 24. April Prof. Jane Lê (WHU) einen Überblick zum Forschungsfeld “Strategy-as-Practice” (SAP) sowie Einblicke in ihre aktuellen Forschungsprojekte. Als Gegenentwurf zu klassisch mikroökonomisch geprägter Strategieforschung, fokussiert SAP auf die konkreten Aktivitäten des “Strategie-Machens” und deren Einfluss auf Erfolg und Misserfolg von Unternehmungen.
Lês Expertise im Bereich der praxistheoretischen Strategieforschung, die eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten zu Themen des RMI bietet (z.B. in Fragen transorganisationaler Strategieprozesse), stieß dabei auf großes Interesse. Die rund 50 Gäste, darunter Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der UW/H, sowie Praktiker und Praktikerinnen, füllten den Veranstaltungsraum bis auf den letzten Platz. Die angeregten Diskussionen zum Vortrag von Prof. Lê wurden beim anschließenden Empfang in entspannter Atmosphäre fortgesetzt.
Wie lässt sich das Verhältnis von Organisation und Psyche theoretisch bestimmen, ohne einem psychologischen Reduktionismus zu folgen, aber auch ohne individuelle Motive und individuelles Handeln zugunsten einer Verdinglichung der Organisation zu übergehen? Und: Lässt sich von Moral, Verantwortlichkeit und gar Schuld nur mit Blick auf individuelle Akteure sprechen, oder gibt es eine Begründung, mit der diese Begriffe auch auf Organisationen bezogen werden können?
Diesen und anderen Fragen ging Prof. Dr. Günther Ortmann am 19. April in seinem Vortrag mit dem Thema “Organisation und Psyche. Über die Moral individueller und korporativer Akteure" an der International Psychoanalytic University in Berlin nach. Im Zentrum seiner Antworten lag dabei der Vorschlag, Antworten mithilfe des Konzepts rekursiver Konstitution von Persönlichkeits- und Gesellschaftsstruktur und der Figur der Emergenz korporativer Akteure zu geben.
Das Wittener Institut für institutionellen Wandel (WIWA) organisierte am 10. April die UW/H-Debatte zum Thema „Korruption, Compliance und Vertrauen in der deutschen Wirtschaft“ in der Stadtbibliothek Witten. RMI Direktor Guido Möllering diskutierte auf dem Podium mit Dirk von Keitz (Compliance Officer Division Europe, HOCHTIEF AG) und Dirk Tänzler (Fakultät für Geschichte und Soziologie, Universität Konstanz), moderiert durch WIWA-Direktor Dirk Sauerland. Professor Möllering betonte, dass der direkte Schaden durch Korruption weniger besorgniserregend sei als der indirekte Schaden durch die Zerstörung von Vertrauen in der Wirtschaft. Compliance-Maßnahmen wiederum könnten zwar zum Wiederaufbau von Vertrauen beitragen, laufen jedoch ihrerseits Gefahr, durch übertriebene Kontrolle wünschenswertes Vertrauen in Wirtschaftsbeziehungen zu verdrängen. In der sehr engagierten und anregenden Debatte wurden viele aktuelle Beispiele betrachtet und Diskussionspunkte aus dem Publikum aufgenommen.
Am 27. Februar 2018 lud das RMI zum Tag der Unternehmensführung an die Universität Witten/Herdecke ein. Unter der Leitfrage „Wie werden Werte Wirklichkeit?“ kamen bei der diesjährigen Veranstaltung mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Spannende Gesprächsimpulse gab es dabei von den hochkarätigen Referenten
Ein kurzer Nachbericht der Veranstaltung findet sich hier.
Innovation und Vertrauen stehen in einem „verflixten“ Verhältnis zueinander, wie Prof. Dr. Möllering in seiner Gastvorlesung am 22.03.2018 im Rahmen des 12. Karl-Vodrazka-Kolloquiums an der Johannes-Kepler-Universität Linz in Österreich zeigte.
„Innovationen erfordern ein Vertrauen, dass das Neue gut und wertvoll sein wird“, erklärte Möllering, „sie zerstören aber auch die Vertrautheit, die Basis für das Vertrauen ist“. Die Forschung zeige zudem, dass Vertrauen zwar eine wichtige Vorbedingung für erfolgreiche Innovationen ist, Vertrauen allein aber noch keine Innovationen hervorbringt. Einige prinzipiell innovationsförderliche Praktiken, wie zum Beispiel Wettbewerbe, wirken wiederum zunächst nicht besonders vertrauensförderlich. Viele Studien kommen zu dem Schluss, dass es von Innovation und Vertrauen weder zu viel noch zu wenig geben sollte. „In beiden Fällen ist es jedoch leichter gesagt als getan, das optimale Maß zu finden“, warnte Möllering, „weil Innovation und Vertrauen beide mit der Ungewissheit über die Zukunft behaftet sind und man deshalb eigentlich erst im Nachhinein weiß, ob man die richtige Balance gefunden hat“.
Außerdem seien Vertrauens- und Innovationsprozesse nur bedingt steuerbar und laufen Gefahr pfadabhängig zu werden. Das Forscherteam am Reinhard-Mohn-Institut betrachtet das „verflixte“ Verhältnis von Innovation und Vertrauen innerhalb von Organisationen, in strategischen Allianzen zwischen Organisationen und auch in regionalen Clustern sowie neuen Organisationsformen. Über alle Ebenen hinweg tauchen zwei Phänomene immer wieder auf, an denen sich zeigt, ob das Zusammenspiel zwischen Innovation und Vertrauen gut funktioniert: Wissenstransfer und Kreativität. Beide können durch Vertrauen befördert oder behindert werden. Beide tragen dazu bei, Innovationen von einem Wunsch, über Ideen und deren Umsetzung, zur Wirklichkeit werden zu lassen.
Nachdem Prof. Dr. Möllering Ende Oktober 2017 von der United Leaders Association (ULA), dem Dachverband der Führungskräfteverbände in Deutschland mit insgesamt rund 60.000M Mitgliedern, in deren Wissenschaftlichen Beirat berufen wurde, fand nun am 21. März 2018 die konstituierende Sitzung des Beirates in Berlin statt. Weitere Mitglieder sind Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing (GPM, Nürnberg), Prof. Dr. Carsten Schermuly (SRH Hochschule Berlin), Harald Winkler (Power of Excellence), Prof. Dr. Jürgen Weibler (Fernuniversität Hagen) und Prof. Dr. Isabell M. Welpe (TU München). Der Beirat tauscht sich mit dem ULA-Vorstand sowie Kommissionen und Arbeitsgruppen der ULA und ihrer Mitgliedsverbände zu diversen Führungsthemen aus, aktuell insbesondere Digitalisierung. „Wir nehmen dabei auf, was Menschen in verantwortungsvollen Positionen heute in der Praxis umtreibt,“ so Möllering, „und können umgekehrt Impulse an tausende Führungskräfte geben“. Der bdvb – Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte gehört der ULA an und hat seit 2017 auch eine Hochschulgruppe an UW/H.
Die Stadt Bochum entwickelt derzeit eine umfangreiche Strategie und hat bereits begonnen sie umzusetzen. Ein „Markt der Ideen“ vom 26.02. bis 05.03.2018 in den Ratssälen des Rathauses diente der Ideenfindung und Diskussion. Prof. Dr. Möllering vom RMI war dazu am 28.02.2018 Gast bei einer Podiumsdiskussion mit der Kämmerin Dr. Eva-Maria Hubbert und dem Dezernenten Sebastian Kopietz, moderiert von Pressesprecher Peter van Dyck. Professor Möllerings Impulsreferat „Wandel gestalten/Vertrauen erhalten“ fand großes Interesse bei den rund 40 Anwesenden aus der Stadtverwaltung. Er stellte veraltete Konzepte des Wandels den neuen Vorstellungen von dynamischen, offenen Veränderungsprozessen gegenüber. Zum dringenden Nachholbedarf der Verwaltung beim Thema Digitalisierung hob Möllering hervor, dass Digitalisierung kein Ziel an sich sein sollte, sondern ein Mittel, mit dem man die eigentlichen Ziele besser erreichen kann, über die man sich womöglich neu verständigen muss.
Adidas-Vorstand Roland Auschel und Leibniz-Preisträger Jens Beckert waren die hochkarätigen Hauptredner dieser RMI-Dialogveranstaltung zur wert(e)orientierten Unternehmensführung. Rund um die inspirierenden Vorträge hatten die mehr als 150 Gäste Gelegenheit zum Netzwerken und zur Vertiefung der Vortragsthemen rund um Imagination, Strategie und Organisation. Mit dem Tag der Unternehmensführung setzte das RMI die Tradition früherer Symposien fort und leistete einen Beitrag zur Förderung des Dialoges zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu wichtigen Themen, die Führungskräfte, Forscher und Gesellschaft bewegen.
RMI-Direktor Guido Möllering hatte die Ehre, den Keynote-Vortrag beim 20. Familienunternehmerkongress (FUK) mit rund 300 Teilnehmenden zu halten. Dem Tagungsthema entsprechend sprach er über „Kooperationen ohne Illusionen“ und stellte sowohl die Chancen als auch die praktischen Herausforderungen von Kooperationsbeziehungen heraus. Er wies darauf hin, dass Familienunternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen eine Reihe von besonderen Hemmnissen hätten, aber in mancherlei Hinsicht ihnen auch förderliche Voraussetzungen zur strategischen Kooperation zugeschrieben werden (z.B. Vertrauenswürdigkeit). Das Motto „Erstmal für immer“ empfahl Professor Möllering im Sinne der notwendigen Ernsthaftigkeit, aber auch Flexibilität von erfolgreichen Kooperationen.
Weitere Informationen zur Keynote und zum Kongress
Seit Mitte Februar 2018 verstärkt Dr. Simone Schiller-Merkens das Team des Reinhard-Mohn-Instituts. Davor war sie an den Universitäten Köln und Mannheim sowie am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln beschäftigt.
In ihrer Forschung widmet sie sich Fragen rund um Markt und Moral mit einem besonderen Augenmerk auf die Entstehung von moralischen Märkten, in denen wirtschaftliche und moralische Prinzipien als sich ergänzend verstanden werden. Am Beispiel des Marktes für „ethical fashion“ konnte sie beispielsweise zeigen, welche Bedeutung soziale Bewegungen für die strategische Positionierung sozialer Unternehmer in diesen Märkten haben. Die Arbeit an diesem Forschungsprojekt wird sie auch am RMI fortführen.
Daneben arbeitet sie derzeit an der Herausgabe eines Bandes zum Thema „The Contested Morality of Markets“, das 2019 in der renommierten Buchreihe „Research in the Sociology of Organizations“ erscheinen wird.
Der jährliche Workshop der Wissenschaftlichen Kommission Organisation (WK ORG) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) fand in diesem Jahr vom 14. bis 16. Februar an der Universität Hamburg statt. Durch die Beiträge des Reinhard-Mohn-Instituts gehörte die Universität Witten/Herdecke zu den dort besonders stark vertretenen Universitäten. Maximilian Heimstädt, Leona Henry, Guido Möllering und Günther Ortmann stellten in drei Fachvorträgen ihre aktuelle Forschung vor und steuerten auch zum Nachwuchsworkshop ihre Kompetenzen bei. Auch bei Moderationen und Koreferaten sowie – besonders prominent – mit der von Günther Ortmann vorbereiteten und geleiteten Podiumsdiskussion zum Thema „Brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht?“ war das RMI präsent.
Regelmäßig erscheint in der Zeitschrift OrganisationsEntwicklung (ZOE) die Kolumne „Ortmanns Ordnung“ von RMI-Forschungsprofessor Günther Ortmann. In seinen Beiträgen bringt Ortmann dabei aktuelle Fragen rund um Management und Führung (von Agilität in Start-ups bis Rigiditäten im Großkonzern) mit klassischen Konzepten aus Organisationstheorie und Geistesgeschichte ins Gespräch. Mit freundlicher Genehmigung der ZOE sind alle Kolumnenbeiträge von Prof. Ortmann erstmals nun auch frei über die Webseite des RMI abrufbar.
Von Februar bis August 2018 verstärkt Elieti Fernandes das RMI als Gastdoktorandin. Ein CAPES/DAAD-Stipendium ermöglicht Frau Fernandes für ein halbes Jahr als Mitglied des RMI-Teams an ihrer Dissertation zum Thema „Competitiveness and Inter-Organizational Relations“ zu arbeiten. Seit 2015 ist sie Doktorandin an der Unisinos Business School nahe Porto Alegre in Brasilien. Bereits im Sommer 2017 hat Frau Fernandes das RMI besucht und einen Einblick in ihre Forschung zur Rolle von Vertrauen in internationalen Unternehmenskooperationen gegeben.
Am 20. Dezember begrüßte das RMI den renommierten Wirtschafts- und Unternehmensethiker Prof. Andreas Suchanek. Im regen Austausch mit Gästen aus Forschung, Studium und Praxis präsentierte er im Rahmen der zweiten RMI Distinguished Lecture seine Arbeit zum Thema „Ein ethischer Kompass für Führungskräfte – Orientierungspunkte in der VUCA-World“.
Prof. Suchanek ergründete dabei, wie Führungskräfte in der heutigen Zeit, die durch Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägt ist, ihren eigenen ethischen Standpunkt reflektieren und zugleich die Verlässlichkeit wechselseitiger Verhaltenserwartungen mit anderen herstellen können.
Nach seiner Promotion bei Karl Homann an der Universität Witten/Herdecke ist Prof. Suchanek mittlerweile Inhaber des Dr. Werner Jackstädt-Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der HHL Leipzig Graduate School of Management geworden.
Maximilian Heimstädt, Postdoc am RMI, hat gemeinsam mit Leonhard Dobusch (Universität Innsbruck) den Artikel „Politics of Disclosure: Organizational Transparency as Multiactor Negotiation“ im Public Administration Review veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit einem der Kernthemen des RMI: dem Management von Offenheit. Konkret beschreiben die Autoren organisationale Transparenz als eine Art Übereinkunft darüber, welche Informationen in welcher Form geteilt werden. Wie diese Übereinkunft jedoch ausgestaltet ist liegt keineswegs auf der Hand, sondern entsteht erst in einem Verhandlungsprozess verschiedenster Akteure mit verschiedensten Interpretationen und Interessen. Empirisch ergründen die Autoren diese „Politik der Preisgabe“ an der Einführung von Open Data in der Berliner Verwaltung. Weitere Informationen zum Artikel finden sich auf der Seite der Zeitschrift: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12895/full
Auf Einladung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft (EGA) sprach RMI-Direktor Guido Möllering bei ihrer Jahrestagung in Köln über die „Zukunft der Unternehmensführung“ vor dem Hintergrund des Tagungsthemas „Digital Leadership“. In seinem Fazit betonte Prof. Möllering, dass „echte“ konzeptionelle Zukunftsentscheidungen – auch im Sinne von Gutenbergs 4. Faktor und gerade im Hinblick darauf, wie die Digitalisierung in Unternehmen umgesetzt und genutzt wird – noch lange eine Aufgabe der Unternehmensführung bliebe, die nicht an Algorithmen delegiert werden könne. Umso mehr müssten Führungskräfte in strategischen Fragen Kreativität beweisen und die Fähigkeit, durch Werte und Sinn zu mobilisieren und Kooperationen zu initiieren. Das hochkarätige Programm der EGA-Jahrestagung ist abrufbar unter: http://www.erich-gutenberg-arbeitsgemeinschaft.de/
Seit Mitte November 2017 verstärkt Claudia Galys das Reinhard-Mohn-Institut als Institutsassistentin. Die gebürtige Wittenerin und gelernte Touristik-Fachwirtin unterstützt das Team des RMI nicht nur in den täglichen Abläufen von Forschung und Lehre, sondern ist auch unmittelbar in die Organisation der Dialogveranstaltungen des RMI eingebunden. In den vergangenen Wochen hat sie das Team um Institutsdirektor Prof. Guido Möllering bereits bei einem Event des Bundesverbandes Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V. (bdvb) und bei der RMI Debatte „Lob der Macht“ mit Rainer Hank (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) sowie Prof. Günther Ortmann (RMI) unterstützt.
Mit seinem neusten Buch „Lob der Macht“ war Dr. Rainer Hank, streitbarer Wirtschaftsjournalist und Leiter der Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2017 nominiert. Am 28. November präsentierte er im Rahmen der zweiten RMI-Debatte an der Universität Witten/Herdecke einige zentrale Thesen seiner Arbeit und stellte sich anschließend dem Koreferat von RMI-Forschungsprofessor Günther Ortmann sowie den kritisch-interessierten Nachfragen des Publikums. Moderiert wurde die Veranstaltung, wie auch die erste RMI-Debatte im Juli 2017, vom Institutsdirektor Prof. Guido Möllering.
Prof. Rainer Strack, Honorarprofessor am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung, ist einer der führenden 40 Köpfe im Personalwesen in Deutschland. Das „Personalmagazin“, das auflagenstärkste deutsche Human-Resource-Journal, zeichnete den Senior Partner der Boston Consulting Group vergangene Woche in Berlin zum sechsten Mal in Folge aus. Nach 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 steht er auch 2017 in der alle zwei Jahr neu aufgelegten Liste der führenden 40 Köpfe im Personalwesen in Deutschland und ist dort der einzige Berater einer großen internationalen Beratungsgesellschaft. Hier finden Sie die Veröffentlichung.
Im Wintersemester 2017/18 leitet Prof. Strack am RMI ein Master-Seminar zum Thema „Strategisches Humanressourcen-Management“.
RMI-Direktor Guido Möllering hat mit Gordon Müller-Seitz (Uni Kaiserslautern) den Artikel „Direction, not destination: Institutional work practices in the face of field-level uncertainty“ im European Management Journal veröffentlicht. Der Beitrag befasst sich mit zentralen RMI-Themen, insbesondere mit unternehmensübergreifenden Prozessen und dem Umgang mit Ungewissheit. Konkret geht es um Praktiken, die in der globalen Halbleiterindustrie bei Kongressen zu beobachten sind. Hierbei versuchen Vertreter vieler führender Unternehmen herauszuarbeiten, wie die Technologie- und Produktionssysteme der Chipherstellung für die Zukunft aussehen werden. Der Artikel zeigt die Bedeutung von Praktiken, die die Unsicherheit nicht direkt beseitigen, aber in der Form beherrschbar machen, sodass die Unternehmen kollektiv eine Ausrichtung finden können. Er leistet damit einen Beitrag zur Forschung über Institutionalisierungsarbeit und die Rolle von Akteuren im institutionellen Wandel. Der Artikel steht frei zum Download.
Möllering, G., & Müller-Seitz, G. (2018). Direction, not destination: Institutional work practices in the face of field-level uncertainty. European Management Journal 36 (1) pp. 28-37
Das „CopServ“-Netzwerk führt verschiedene Akteure zusammen, die sich um die Anwendung der vielfältigen Messdaten des europäischen Satellitenprogramms „Copernicus“ bemühen, um innovative Kooperationsprojekte in diesem Bereich zu fördern. Zu den Mitgliedern gehören kleine und mittlere Unternehmen (KMU), wie auch wissenschaftliche Institute und Hochschulen. Das Netzwerk wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) der Bundesregierung gefördert und von der ZENIT GmbH koordiniert. Das Reinhard-Mohn-Institut (RMI) ist in diesem Zusammenhang, und auch auf andere Initiativen bezogen, zu Fragen des Netzwerkmanagements u.a. mit Peter Loef von Zenit im Austausch. Zum 4. „CopServ“-Treffen an der TH Georg Agricola in Bochum trugen Leona Henry und Guido Möllering vom RMI mit Referaten über die Evaluation von Netzwerken und die Rolle von Vertrauen in Netzwerken bei.
Nachdem zum Jahresbeginn 2017 Guido Möllering das Journal of Trust Research als Editor-in-Chief übernommen hat, inzwischen unterstützt von Leona Henry als Managing Editor, erschien nun die erste vollständig vom neuen Team betreute Ausgabe der führenden internationalen Fachzeitschrift der Vertrauensforschung mit fünf Artikeln, einem Interview (mit Roy Lewicki), zwei Buchrezensionen und einem Editorial, in dem Möllering argumentiert, dass die Zeitschrift ein weites Feld der Vertrauensforschung zu bestellen hat. Die Beiträge des zweiten Heftes des siebten Jahrgangs dieses Journals reichen von Studien zur Vertrauens(un)würdigkeit von Tatoos, über Zusammenhänge zwischen organisationaler Legitimität und Vertrauen sowie die Rolle von Vertrauen bei der Reform des öffentlichen Sektors, bis hin zur Frage, wie das Vertrauen von Verbrauchern in Fast Food Restaurants mit dem Vertrauen in die kontrollierenden Behörden zusammenhängt. Die Zeitschrift ist zu finden unter: http://www.tandfonline.com/toc/RJTR20/current
Zur Förderung von freiem Wissen und offener Wissenschaft ernennt die Wikimedia Deutschland, gemeinsam mit dem Stifterverband und der VolkswagenStiftung, jährlich eine kleine Zahl an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern zu „Open Science Fellows“. Für die Kohorte 2017/18 wurde Maximilian Heimstädt als einer von 20 interdisziplinären Nachwuchsforschenden für das Förderprogramm ausgewählt. In Rahmen des Fellowships wird er, gemeinsam mit Prof. Leonhard Dobusch (Universität Innsbruck), an einem offen lizenzierten Lehrbuch zum Thema „Open Organizing“ arbeiten. Eng verbunden mit diesem Projekt ist das von Maximilian Heimstädt an der Universität Witten/Herdecke angebotene Seminar „Current Issues in Management: Open Organizing“.
Mit der UW/H Abteilung „Professional Campus“ und dem Beratungsunternehmen hs:results hat das RMI ein Managementprogramm zum Thema „Kooperationsmanager/in“ entwickelt, das drei zweitägige Module über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr umfasst und die Teilnehmenden in die Lage versetzt, eine Experten-, Führungs- und Vermittlungsrolle für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Projekten und mit Geschäftspartnern zu übernehmen. Das Programm wird zum ersten Mal von März bis Juni 2018 angeboten. Weitere Informationen hier:
Das Institute for Conflict Cooperation and Security (ICCS) der Universität Birmingham veranstaltete am 21. September 2017 den interdisziplinären Workshop zum Thema “Finding Trust in Social Sciences”. Das RMI war mit Leona Henry und Guido Möllering gleich mehrfach im Programm vertreten: Leona Henry stellte ein Paper vor, das eine genauere Vorstellung davon entwickelt, wie Vertrauen für die soziale Verantwortung von Unternehmen in Netzwerken förderlich sein kann. Guido Möllering hielt eine Keynote zum unterbelichteten Begriff der Verwundbarkeit, sprach in einem Podiumsbeitrag über die kontinuierliche Messung kollektiven Vertrauens und stellte das Journal of Trust Research vor.
Mit großer Freude hat das RMI die Nachricht aufgenommen, dass der von Prof. Ortmann (mit Jörg Sydow) verfasste Aufsatz „Dancing in chains: Creative practices in/of organizations“ zur Veröffentlichung im A-Journal Organization Studies angenommen wurde. In dem Artikel wird Nietzsches Argumentation, dass man durch Selbstbeschränkung in die Lage versetzt wird, etwas anders machen zu müssen und damit etwas Neues hervorbringen zu können, für die Forschung über Innovation und Kreativität in Organisationen nutzbar gemacht.
Bekanntermaßen gilt die Jahrestagung der Academy of Management als weltweit größte und wichtigste wissenschaftliche Tagung zum Thema Management. Sie fand in diesem Jahr vom 4. bis 8. August in Atlanta statt. Prof. Möllering trug dabei zu insgesamt drei Programmpunkten inhaltlich bei, unter anderem mit einem Symposium-Vortrag zum Thema „Vulnerability: The Achilles‘ Heel of Trust Research?“
Am 31. Juli 2017 fand in Zusammenarbeit mit dem Seminar für ABWL, Unternehmensentwicklung und Organisation (Prof. Ebers) an der Universität zu Köln der 2. Impulstag des RMI statt. Zu den Impulsgebern zählten diesmal u.a. Dr. Hendrik Wilhelm (Uni Köln), Prof. Sigrid Quack (Uni Duisburg-Essen), Dr. Achim Oberg (Uni Mannheim, Foto) und Prof. Alfred Kieser (RMI). Aus den Reihen des RMI stellte Dr. Maximilian Heimstädt eine Forschungsarbeit mit dem Titel „Bringing open innovation to city hall: The role of inter-field framing“ (mit Georg Reischauer) vor.
Zehn Jahre nach dem Beginn der globalen Finanz- und Bankenkrise sprach RMI-Direktor Guido Möllering mit Arthur Dittmann auf Bayern 2 darüber, ob das in der Krise verlorene Vertrauen zurück gewonnen werden konnte. Professor Möllering wies darauf hin, dass die Vertrauenswerte der Banken nach wie vor problematisch sind, dass die Banken sich immer noch „verkriechen“ vor ihrer Verantwortung, dass aber auch eine gewisse Normalität wieder eingekehrt ist. In der Krise waren die Verbraucher verunsichert, aber die persönliche Betroffenheit „verschwimmt“ mit der Zeit. Möllering sieht die Banken weiterhin in der Pflicht und warnt zugleich allgemein davor, dass sich bei Verbrauchern eine misstrauische Weltsicht verfestigen kann, die nicht mehr für das Wiederherstellen von Vertrauen in Institutionen offen ist. Hier sieht er eine Verantwortung und Chance auch von Unternehmen, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter die Ungewissheit, die mit Vielfalt einhergeht, auszuhalten und zu schätzen lernen. Das Interview wurde am 13. Juli 2017 in einem Schwerpunkt des Vormittagsmagazins "Notizbuch" auf Bayern 2 gesendet.
„Charisma macht nicht Unternehmer außergewöhnlich erfolgreich, sondern außergewöhnlicher Erfolg macht Unternehmer charismatisch“, so lautet die These des Gastprofessors am RMI, Alfred Kieser, und seiner Koautorin Fabiola Gerpott in ihrem kürzlich in der Zeitschrift „Managementforschung“ veröffentlichten Aufsatz. Dass dennoch so viel Aufmerksamkeit auf charismatische Unternehmerpersönlichkeiten gerichtet wird, deuten Kieser und Gerpott als Beleg für eine verbreitete Ideologie des Entrepreneurships und post-faktische Verschleierung der tatsächlichen Erfolgsaussichten von Start-ups.
Bei der ersten RMI Debatte am 10. Juli diskutierten Kieser und Gerpott diese Behauptungen mit einem Panel aus Unternehmern, Gründer-Förderern, Wissenschaftlern und Studierenden, u.a. mit Peter Pohlmann, Sebastian Borek, Sabine Bohnet-Joschko und Malte Schnittke.
Vom 5. bis 8. Juli fand an der Copenhagen Business School das diesjährige EGOS Colloquium unter dem Oberthema „The Good Organization“ statt. Mit den Professoren Sabina Siebert (Glasgow) und Søren Jagd (Roskilde) organisierte Prof. Möllering die Themengruppe zu „Trust-based Organizing: Principles and Politics“. Dort hielt Prof. Möllering einen Vortrag über „Trust trap? Path-dependent dynamics of trust-based organizing“ (mit Jörg Sydow), Leona Henry sprach zu “Collective organization of CSR: The role of trust as an organizing principle”. Prof. Ortmann hatte beim diesjährigen EGOS Colloquium eine prominente Rolle auf dem Podium des Sub-Plenarys zum Thema „The Communitive Construction of ‚Good‘ Organizational Actorhood“ zusammen mit Patricia Bromley (Stanford) und François Cooren (Montréal).
Transparenz wird zunehmend als Grundlage guter Unternehmensführung verstanden. Doch welche Form der Transparenz hilft wirklich? Wie verändert Transparenz die Vertrauensbeziehungen des Unternehmens? Wo liegen die Grenzen der nützlichen und zumutbaren Transparenz? Für bdvb aktuell sprach hierzu Dilara Wiemann von der neuen bdvb-Hochschulgruppe an der Universität Witten/Herdecke mit Prof. Guido Möllering und Dr. Maximilian Heimstädt vom RMI.
RMI-Direktor Guido Möllering war Podiumsgast beim 43. Herrenhäuser Gespräch zum Thema „Vertrauen – Unsere Sehnsucht nach Gewissheit“ am 2. März 2017 in Hannover, einer Veranstaltungsreihe von VolkswagenStiftung und NDR Kultur. Etwa 250 Zuhörer waren bei der Aufzeichnung dabei und die Diskussion wurde in voller Länge am 2. April 2017 im Radio und online ausgestrahlt. Professor Möllering betonte u.a., dass Vertrauen eine Grundlage der Marktwirtschaft ist, in der sich nicht alles kalkulieren lässt, dass Zugehörigkeit und eine gemeinsame Zukunftsperspektive einerseits Gemeinschaft erzeugen, jedoch andererseits ökonomisches Wachstum ohne die Offenheit für Fremdes und die Bereitschaft zur Veränderung stark begrenzt ist. Die Sendung ist in der NDR Mediathek verfügbar.
Am 26. Juni begrüßte das RMI Prof. Tim Bartley von der Ohio State University. Im Rahmen der ersten RMI Distinguished Lecture sprach Bartley zum Thema: „The Role of Corporations in Institutional Emergence, Transnational Governance, and Sustainability“. Bartley gehört zu den international führenden Wirtschaftssoziologen und hat in 2015 das Buch Looking Behind the Label: Global Industries and the Conscientious Consumer veröffentlicht. Er hält derzeit die renommierte „Scholar-in-Residence“-Position am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Vom 14. bis 16. Juni 2017 nutzte Leona Henry die Möglichkeit, ihr Dissertationsthema bei der Alliance for Research on Corporate Sustainability (ARCS) Conference in Rotterdam vorzustellen. Ihre Teilnahme wurde durch eines von fünf Reisestipendien der ARCS Konferenz gefördert.
Das Team des RMI freut sich über die Veröffentlichung des von Dr. Heimstädt verfassten Artikels „Openwashing: A decoupling perspective on organizational transparency“ in der führenden Zeitschrift Technological Forecasting and Social Change. Anhand empirischer Fälle aus New York, London und Berlin erforscht der Artikel das Spannungsfeld zwischen eingeforderter Transparenz und notwendiger Verschlossenheit, in dem sich vor allem Organisationen des öffentlichen Sektors zunehmend wiederfinden.
Der Artikel findet sich hier.
Heimstädt, M. (2017). Openwashing: A decoupling perspective on organizational transparency, Technological Forecasting and Social Change 125 (December 2017) pp. 77-86
Am 8. März 2017 organisierte das RMI in Oslo mit dortigen Kooperationspartnern und weiteren Fachvertretern aus Norwegen einen Paper-Workshop, der insbesondere auch jungen Forschern wie Leona Henry vom RMI die Gelegenheit bot, Feedback zu laufenden Forschungs- und Publikationsprojekten zu bekommen und sich international zu vernetzen. Finanziert wurde der Workshop wie auch ein Besuch der Professoren Gausdal und Svare in Witten im Februar 2017, aus einem Drittmittelprojekt der norwegischen Forscher, in dem das RMI als Kooperationspartner mitarbeitet. Im Anschluss an den Paper-Workshop hielten die Professoren Gausdal, Svare und Möllering auf Einladung von Prof. Huse am 9. März 2017 einen Gastvortrag an der BI Norwegian Business School.
Der jährliche Workshop der Wissenschaftlichen Kommission Organisation (WK ORG) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) ist die wichtigste deutschsprachige Tagung in der Organisationsforschung. Sie fand in diesem Jahr vom 15. bis 17. Februar in Hamburg statt und das RMI war mit Vorträgen von Prof. Ortmann „Organisation, Institution, Kafka: Bootstrapping avant la lettre“, Dr. Heimstädt „Zur Dualität von Macht und Raum“ und Prof. Kieser „Does charisma make extraordinarily successful entrepreneurs or does extraordinary success make entrepreneurs charismatic? On the ideology of entrepreneurship“ sowie Prof. Möllering als Moderator vertreten.
In einem aktuellen Artikel in der Zeitschrift „Die Betriebswirtschaft (DBW)“, Heft 76 (6), Seite 467-476, arbeitet Alfred Kieser, seit Oktober Gastprofessor am RMI, gravierende Mängel des derzeitigen Systems wissenschaftlicher Veröffentlichungen heraus und beleuchtet die Alternative des „Post Publication Reviews“. Diesen Artikel verfasste Kieser, bevor er wusste, dass Schäffer-Poeschel die altehrwürdige DBW mit Ablauf dieses Jahres einstellen würde und die Zeitschrift damit Opfer genau der Entwicklungen ist, die Kieser in seinem Beitrag kritisiert.
DBW-Website
In dem von Sebastian Giacovelli herausgegebenen Band „Die Energiewende aus wirtschaftssoziologischer Sicht“ (2017, Springer) zeigt RMI-Direktor Guido Möllering in seinem Kapitel, wie der technologische Wandel hin zu erneuerbaren Energien mit der Entstehung neuer Märkte verknüpft ist. Am Beispiel des deutschen Marktes für Solartechnologie von 1990 bis 2007 macht sein Beitrag deutlich, welche Rolle die Marktakteure für die Emergenz, Koordination und Regulation marktkonstituierender Elemente spielen. Das Gelingen der Energiewende hängt von einem transorganisationalen Wandel ab.
Weitere Informationen zum Buch
Das Reinhard-Mohn-Institut wird Editorial Office des Journal of Trust Research, das ab Januar 2017 mit Guido Möllering einen neuen Herausgeber (Editor-in-Chief) hat. Die Zeitschrift erscheint bei Routledge und bietet ein einzigartiges Forum für die Vertrauensforschung. Sie zeichnet sich durch Interdisziplinarität, Internationalität, Qualität (Peer-Review) und auch unkonventionelle Textformate aus.
Journal-Website
Prof. Sabina Siebert (Uni Glasgow) und Prof. Søren Jagd (Uni Roskilde) hielten am 2. Dezember 2016 Gastvorträge im Rahmen des vom RMI durchgeführten Seminars „Trust-based Organizing“. Prof. Siebert forderte eine stärkere Berücksichtigung des gesellschaftlichen Umfeldes in Studien über Vertrauen in Unternehmen und Prof. Jagd stellte am Beispiel der Stadtverwaltung von Kopenhagen vor, mit welchen Schwierigkeiten bei der Einführung einer vertrauensbasierten Führung zu rechnen ist. Das Seminar beleuchtet, wann vertrauensbasierte Organisationsformen möglich und wünschenswert sind, und wem sie nützen.
Beim 9. Workshop zu “Trust Within and Between Organizations” des FINT-Netzwerks in Dublin, 17.-18. November 2016, mit ca. 120 internationalen Teilnehmern war RMI-Direktor Guido Möllering mit Beiträgen zu den Themen „Vertrauen von Führungskräften in Mitarbeiter“ (mit Simon Schafheitle und Antoinette Weibel), „Vertrauen in Teams“ (mit Catalina Dumitru), „Generalisiertes Vertrauen“ und „Politische Perspektiven auf Vertrauen“ vertreten und stellte den Keynote Speaker Bill McEvily (Uni Toronto) vor. Prof. Möllering ist seit 2010 im FINT Board, das dieses Netzwerk organisiert.
Das 5. Treffen des von der DFG geförderten wissenschaftlichen Netzwerks zum Thema „Das ungenutzte Potential des Neo-Institutionalismus“ fand am 3. und 4. November 2016 am Munich Center for Technology in Society an der TU München statt. Das RMI wurde von Maximilian Heimstädt vertreten, der ein gemeinsam mit Guido Möllering verfasstes Arbeitspapier zur Emergenz institutionellen Wandels vorstellte. In ihrer Keynote präsentierte Julia Brandl (Innsbruck) eine aktuelle Studie zu Identitätskonflikten von Führungskräften.
RMI-Direktor Prof. Dr. Guido Möllering hielt am 3. November 2016 im Rahmen des Studium Generale (Ringvorlesung) der Eberhard-Karls-Universität Tübingen einen Vortrag über „Vertrauen ohne Vertrautheit? Mechanismen des interkulturellen Kooperationserfolgs“. Dabei ging es im Kern um den Umgang mit Unvertrautheit und um die Chancen, die sich dabei – trotz der sich zunächst aufdrängenden Probleme – bieten. Das Studium Generale an der Uni Tübingen sucht die wissenschaftsgeleitete Auseinandersetzung in Gegenwartsfragen, behandelt Grundfragen der menschlichen Existenz und bietet das Gespräch über die Grenzen der Einzeldisziplin hinaus.
Zur Website des Programms
Prof. Dr. Günther Ortmann, Forschungsprofessor am RMI, hielt im Oktober 2016 verschiedene Vorträge in Heidelberg und Hamburg. Der erste Vortrag „Das Spiel des Zweifelns und der Zwang zur Entscheidung. Ein Quantum Trost für Zweifler und Zauderer“ fand auf dem Symposion „Die Kraft des Zweifelns. Systemische Praxis in Zeiten ‘sicheren’ Wissens“ vom 13.-15.10.2016 in Heidelberg statt. Ausgerichtet wurde das Symposion von Familiendynamik und dem Heidelberger Institut für systemische Forschung und Therapie.
Außerdem wurden an der Universität Heidelberg vom 21.-22.10.2016 die „Unternehmensrechtlichen Tage 2016“ der Universitäten Heidelberg, Köln, Linz und München veranstaltet. Prof. Ortmann referierte in seinem Vortrag über das „Unternehmensstrafrecht: Sechs Thesen, sechs Fragen“.
Am 27.10.2016 an der Bucerius Law School in Hamburg fand sein Vortrag "Als Ob. Über notwendige Fiktionen im Alltag, in der Ökonomie und im Recht" auf dem Symposium „Zwischen Positivismus und Postmoderne: Herausforderungen für das Recht im 21. Jahrhundert“ statt.
Maximilian Heimstädt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am RMI, vertrat das Institut vom 13. bis 16. Oktober 2016 auf dem Momentum-Kongress im österreichischen Hallstatt. Die jährliche Veranstaltung bietet eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis mit dem Ziel, die drei Bereiche zu verbinden und zu verändern. Das Treffen im Oktober 2016 stand unter dem Thema „Macht“. Gemeinsam mit Julia Bartosch (Freie Universität Berlin) stellte Maximilian Heimstädt im Track zu „Grundlagen der Macht“ von Isolde Charim (Publizistin) und Richard Weiskopf (Universität Innsbruck) ein aktuelles Forschungspapier zur Beziehung von formaler Macht und sozial konstruiertem Raum in Organisationen vor. Heimstädt: “Besonders in Zeiten von Open Plan-Büros und Hot Desking stellt sich die Frage, wie sich die zunehmende Fluidität des Raumes auf Fragen der Hierarchie und Führung in Organisationen auswirkt.”
Mehr zum Momentum Kongress
Das sechste Treffen des DFG-geförderten wissenschaftlichen Netzwerks zum Thema „Field-Configuring Events: Time, Space and Relations“ (SCHU 2872/1-1) fand am 6. und 7. September 2016 an der Johannes Kepler Universität Linz statt. Das RMI hat das Treffen mitgestaltet. Diesmal ging es darum, welche Rolle Events beim Organisieren von Kreativität spielen, ebenso kamen sie als kreative Organisationsformen zur Sprache. Keynotes zu diesem interdisziplinären Austausch gaben Harald Bathelt (Toronto) und Martin Müller (Zürich). Der praktische Bezug wurde beim Besuch der Tabakfabrik Linz, heute ein Kreativ-Areal, eindrucksvoll hergestellt.
Mit norwegischen Kollegen hat RMI-Direktor Prof. Dr. Guido Möllering untersucht, warum nicht alle Netzwerke zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), in denen ein hohes Maß an Vertrauen herrscht, gleichermaßen einen Nutzen für die Mitglieder und das Netzwerk insgesamt erzielen. Dabei kam heraus, dass die Kooperation zwar ein Mindestmaß an Vertrauen erfordert, es aber noch nicht den Anstoß zur Zusammenarbeit gibt, sondern vielmehr erst die gelungene Kooperation vertrauensbildend und zugleich nutzenstiftend wirkt. In der Praxis gilt es also, das Dilemma zu durchbrechen, dass Partnerschaft Vertrauen erfordert, Vertrauen aber erst entsteht, wenn die Netzwerkbeziehungen dynamisch mithilfe konkreter, nützlicher Kooperationsanlässe aufgebaut werden.
Weniger Nutzen entsteht im Netzwerk, wenn die Mitglieder sich zwar vertrauen, sich aber nur vordergründig den gemeinsamen Zielen verschrieben haben und mit der Mitgliedschaft eigentlich anderes verfolgen. So war es etwa bei einem norwegischen KMU-Netzwerk, das Innovationen produzieren sollte, aber für das Hochschul-Recruiting genutzt wurde. Die Studie von Anne H. Gausdal, Helge Svare und Guido Möllering ist im „Journal of Trust Research“ erschienen.
Zur Studie
In einer Pressemeldung vom 23. August 2016 äußert sich Prof. Dr. Guido Möllering zum Streit zwischen Volkswagen und Prevent: Die Auseinandersetzung unterstreiche die strategischen Chancen und Herausforderungen von Kooperation als Schlüsselkategorie für die Unternehmensführung.
Zur Meldung
Vom 7. bis 9. Juli 2016 fand das jährliche Colloquium der European Group for Organizational Studies (EGOS) in Neapel statt. RMI-Direktor Prof. Dr. Guido Möllering organisierte und leitete dort zusammen mit den Professorinnen Nicole Gillespie (University of Queensland), Rosalind Searle (Coventry University) und Antoinette Weibel (Universität St. Gallen) die Themengruppe „Trusting: The Practices and Process of Organizational Trust“. Die Tagung gehört mit gut 2.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen in der Organisationsforschung. In der Themengruppe präsentierten und diskutierten etwa 50 Forscher und Forscherinnen aus allen Kontinenten etwa zwei Dutzend neue Studien zum Thema Vertrauen in Organisationen. Professor Möllering: „Die Forschung bestätigt, dass Vertrauen nicht auf statische Entscheidungen reduziert werden kann, sondern in sich fortschreibenden und wandelnden Praktiken verstanden werden muss.“
Knapp ein Jahr nach Erscheinen der zweiten Auflage des „Handbook of Research Methods on Trust“, das RMI-Direktor Prof. Dr. Guido Möllering zusammen mit den britischen Professoren Fergus Lyon und Mark N.K. Saunders herausgibt, ist die deutlich erschwinglichere Taschenbuchausgabe vom Edward Elgar Verlag verfügbar. Zu dem Handbuch haben zahlreiche international renommierte Vertrauens-Forscherinnen und -forscher beigetragen. Es zeichnet sich durch Interdisziplinarität und Methodenvielfalt aus. Inhaltsverzeichnis und das einleitende Kapitel finden Sie hier.
Informationen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 Abs. 2 S. 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Datenschutzinformationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Organisationskultur“
Die Universität Witten/Herdecke ist durch das NRW-Wissenschaftsministerium staatlich anerkannt und wird – sowohl als Institution wie auch für ihre einzelnen Studiengänge – regelmäßig akkreditiert durch: